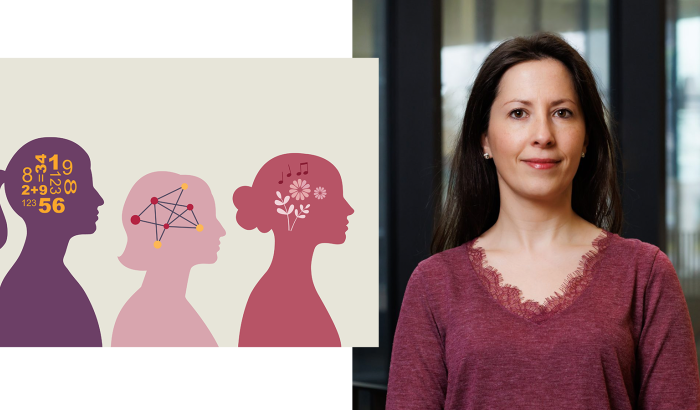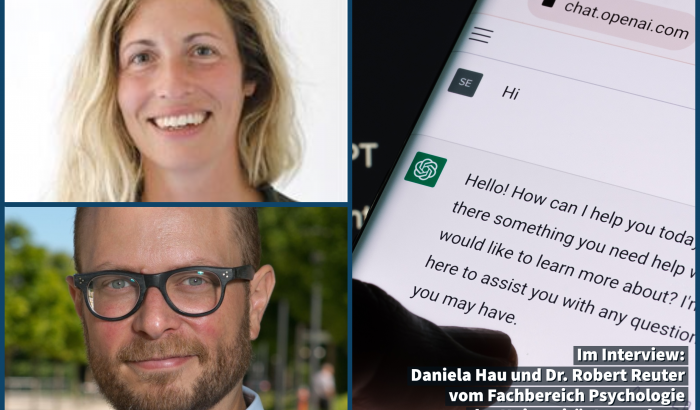(C) Uwe Hentschel
Fernand Anton forscht über die Auswirkungen von Stress auf Schmerzempfindung.
Fernand Anton, Sie untersuchen, wie sich Stress auf das Schmerzempfinden auswirkt. Wo liegt da der Zusammenhang?
Der bekannteste Zusammenhang ist wohl die so genannte stress-induzierte Analgesie, also der Schmerzlinderung, bei der das Schmerzempfinden mit Hilfe des Nervensystems kurzfristig reduziert wird. Zum Beispiel ein schwerer Unfall: Die Mutter, schwer verletzt, zieht ihr Kind aus dem Auto und ignoriert ihre eigenen Schmerzen. Das ist schon länger bekannt und man kennt auch die Abläufe im Körper. Doch ist verschiedenen Forschern aufgefallen, dass es möglicherweise Bedingungen gibt, wo eben nicht die stress-induzierte Schmerzminderung auftritt, sondern eher eine durch Stress verursachte Schmerzverstärkung.
Und woran forschen Sie?
Wir betreiben in unserem Labor ja ausschließlich Schmerzforschung und bereiten derzeit eine Untersuchung vor, die sowohl tier- als auch humanexperimentell laufen soll. Und zwar wollen wir herausfinden, welchen Einfluss Stresseinwirkungen im ganz frühen Lebensstadium haben. Wir gehen davon aus, dass in dieser Phase viele biochemische Reaktionen für den Rest des Lebens programmiert werden, dass also Menschen, die schon früh mit Stress konfrontiert werden, auf Stress im späteren Leben erst mal vorbereitet sind.
Das heißt, wer eine stressige Kindheit hat, kommt später mit Stress besser zurecht?
Nicht unbedingt. Denn zu viel Stress kann zu Gesundheitsproblemen führen. Je länger und intensiver diese spätere Stressphase ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der positive Affekt ins Negative kippt. Und ein Bereich, der dabei relevant ist, ist das Schmerzempfinden. Diese Menschen sind wahrscheinlich anfälliger für chronische Schmerzzustände, die oft mit psychologischen Problemen wie Ängstlichkeit oder Depressivität einhergehen. Und das wollen wir herausfinden.
Wie lassen sich denn Informationen über eine stressige Kindheit oder Frühphase erfassen?
Tierexperimentell haben wir schon einige Erkenntnisse und es ist geplant, diesbezüglich auch mit der medizinischen Universität Innsbruck zusammenzuarbeiten, um etwas über die Zellmechanismen zu erfahren. Parallel dazu planen wir Komplementärstudien mit Menschen. Dazu wollen wir Stress- und Schmerzuntersuchungen mit Menschen machen, die zu früh geboren wurden, einige Zeit im Brutkasten verbracht haben und daher vermehrt Stress-Situationen ausgesetzt waren.
Warum ist es wichtig, diesen Zusammenhang zu kennen?
Es gibt einige Schmerzsyndrome, von denen man nicht weiß, wo sie herkommen. Zum Beispiel die berühmte Fibromyalgie, bei welcher der Bewegungsapparat die ganze Zeit schmerzt, oder aber chronische Rücken-, Unterbauch- und Darmbeschwerden. Das alles sind Syndrome, die nicht ausschließlich, aber doch maßgeblich mit Stressverarbeitung zusammenhängen.
Kann das Schmerzempfinden auch anders beeinflusst werden?
Ja. Wir wissen zum Beispiel, dass sich lang anhaltender Schmerz an einem Körperteil verringert, wenn wir uns an einem anderen Körperteil Schmerz hinzufügen. Wir haben dazu auch eine Studie gemacht, bei der wir den zweiten Schmerz dann mit einem Klingelton kombiniert haben. Das heißt, jedes Mal, wenn sich durch den zweiten Schmerz das erste Schmerzempfinden verringert hat, ertönte der Klingelton. Das haben wir dann mehrfach wiederholt und schließlich festgestellt, dass irgendwann der Klingelton alleine ausreichte, um den ersten Schmerz zu reduzieren.
Und was bringt diese Erkenntnis?
Das Ganze klingt zunächst nach Spielerei. Aber es ist letztlich die Grundlage für eine mögliche Therapie. Darauf aufbauend kann man vielleicht Trainingsprogramme entwickeln, mit deren Hilfe Betroffene lernen können, ihr Schmerzempfinden zu reduzieren.
Autor: Uwe Hentschel
Foto: Uwe Hentschel