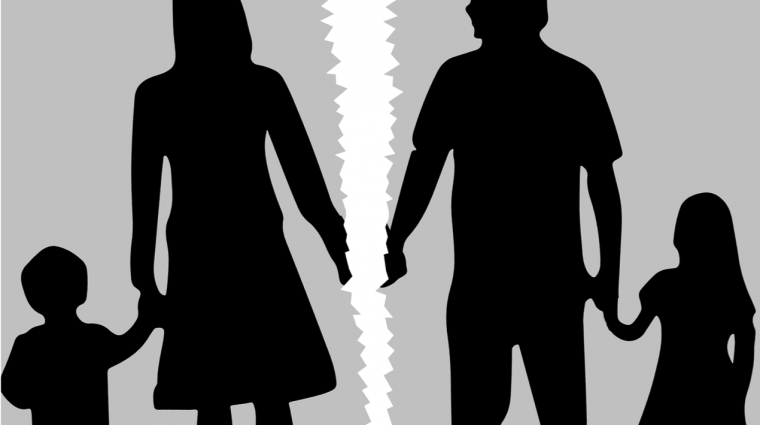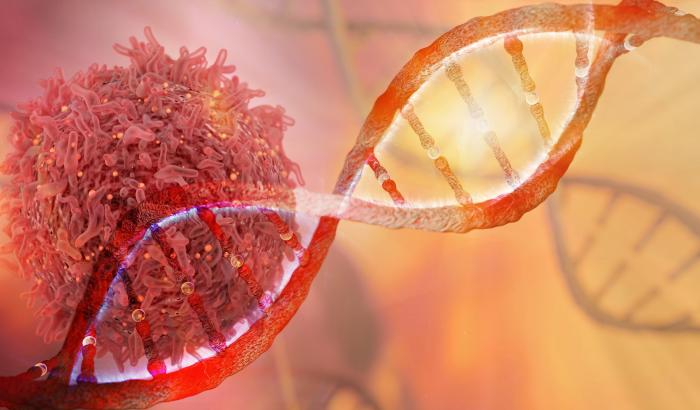(C) FNR
Gökhan Ertaylan, Sie hatten vor kurzem die Gelegenheit als einziger Teilnehmer aus Luxemburg beim Lindau Nobel Laureate Meeting 37 Nobelpreisträger in Physiologie und Medizin persönlich kennenzulernen. Wie haben Sie diese Erfahrung empfunden?
Meine Erwartungen wurden übertroffen. Heutzutage ist ein Nobelpreisträger ähnlich wie ein Oscar-gekrönter Regisseur oder ein Bestseller-Autor ein Vorbild für zukünftige Generationen. In Lindau konnte ich die Einstellungen und Geschichten der prominentesten Wissenschaftler meiner Generation aus erster Hand beobachten und hören, anstatt nur die idealisierte Version die meistens in den Medien portraitiert wird.
Und was waren Ihre Einsichten?
Nobelpreisträger sind auch nur Menschen. Sie machen Fehler wie durchschnittliche Wissenschaftler auch, vielleicht sogar noch mehr, aber sie geben nie auf. Alle Nobelpreisträger, die ich auf dem Meeting getroffen habe, arbeiten an einer Idee, ganz einfach weil sie interessiert sind - nicht weil es ihnen persönlichen Ruhm oder Anerkennung bringt. Es war inspirierend zu sehen, dass das wissenschaftliche Feuer z.B. auch noch in einem 90-jährigen brennt, der seit mehr als 50 Jahren in der Forschung arbeitet!
Am LCSB untersuchen Sie die Eigenschaften von Brustkrebszellen, die Metastasen bilden. Haben Sie in Lindau neue Ideen für Ihr Projekt bekommen?
Ja, auf jeden Fall. Dank Elisabeth Blackburn aus Australien (Nobelpreisträgerin in 2009) habe ich jetzt ein besseres Verständnis des Alterungsprozesses bei Zellen und Gewebe. Der ist bei jedem anders, und zusammen mit Genetik und Umwelteinflüssen könnte er eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Krankheiten wie z.B. Brustkrebs spielen.
Auβerdem wurde mir wiederum klar, dass der Naturwissenschaftler von heute sich nicht mehr an das traditionelle Schema des Forschers halten kann, wenn er in seinem Gebiet erfolgreich sein will.
Können Sie das genauer erklären?
Traditionell wird ein Forscher in der Biologie oder Medizin als Spezialist in seinem Fachgebiet betrachtet, wenn er in der Lage ist Hypothesen aufzustellen, Experimente zu planen und durchzuführen, und Resultate zu analysieren. Gleichzeitig muss er neue Erkenntnisse aus der Fachliteratur herauslesen und integrieren, und dafür sorgen, dass seine Entdeckungen auch veröffentlicht werden.
In den letzten 15 Jahren haben sich neue Technologien so schnell entwickelt, dass wir jetzt weit mehr Resultate produzieren als wir auswerten können. Wir können heute das gesamte Erbgut eines Menschen in unter einer Woche sequenzieren, brauchen aber Wochen oder sogar Monate um die Daten zu verarbeiten. Das gleiche gilt für Publikationen: in meinem Fachgebiet wurden z.B. in den letzten 12 Monaten über 14.000 Artikel veröffentlicht. Das sind knapp 40 Publikationen pro Tag, die ich theoretisch lesen müsste!
Was können Wissenschaftler gegen diesen Engpass tun?
Generell brauchen wir starke Zusammenarbeiten und ein gutes Verständnis in verschiedenen Disziplinen. Für die Fachliteratur können wir Algorithmen und semi-automatische Sammelprozesse aus der Informatik nutzen. Auch bei der Datenanalyse nutzen wir den Computer als eine Erweiterung unseres Gehirns, ohne dabei den biologischen Kontext zu ignorieren. Danach ist es genauso wichtig, zurück ins Labor zu gehen und die Resultate der theoretischen Analyse zu testen.
Welches Arbeitsmotto tragen Sie von dem Treffen davon?
Arbeite an etwas, das dich wirklich interessiert. Suche nicht nach Ausreden!
Interview: Michèle Weber (FNR)
Photo © FNR
Infobox
Bei dem Treffen im Juli 2014 trafen 600 junge Wissenschaftler aus 80 Ländern 37 Nobelpreisträger in Physiologie und Medizin, darunter auch den gebürtigen Luxemburger Jules Hoffmann, der 2011 den Nobelpreis erhielt. Das jährliche Treffen in dem malerischen Lindau wurde in den fünfziger Jahren unter der Schirmherrschaft der Adelsfamilie Bernadotte ins Leben gerufen, mit dem Ziel die wissenschaftliche Elite und junge hochmotivierte Forscher aus aller Welt zusammenzubringen. Seit 2009 unterstützt der FNR 1-2 talentierte Nachwuchswissenschaftler aus Luxemburg, um an diesem einzigartigen Treffen teilzunehmen. Die Ausschreibung für das nächste Lindau Nobel Laureate Meeting im Sommer 2015 ist für Oktober 2014 vorgesehen.
Mehr Informationen zum Lindau Nobel Laureate Meeting: http://www.lindau-nobel.org
Gökhan Ertaylan ist seit 2012 wissenschaftlicher Mitarbeiter (Postdoktorand durch den FNR unterstützt) im Computational Biology Group am Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB) der Uni Luxemburg. Nach einem Studium in Electrical & Electronics Engineering an der Boğaziçi University in Istanbul entschied der gebürtige Türke sich seine Karriere in Richtung Biologie zu orientieren. Er machte einen Master in Bioinformatik und Genetik an der Universität Utrecht und interessierte sich anschliessend während seiner Doktorarbeit in Computational Systems Biology an der Universität Amsterdam für den HIV Virus. Am LCSB arbeitet Gökhan an Brustkrebs: er sucht nach molekularen Veränderungen, die in metastasierenden Krebszellen entstehen. Solche Merkmale könnten in Zukunft helfen, Krebspatienten in unterschiedliche Gruppen zu unterteilen und ihnen eine auf sie abgestimmte Behandlungsform anzubieten. Mehr Informationen: http://wwwde.uni.lu/lcsb/people/goekhan_ertaylan