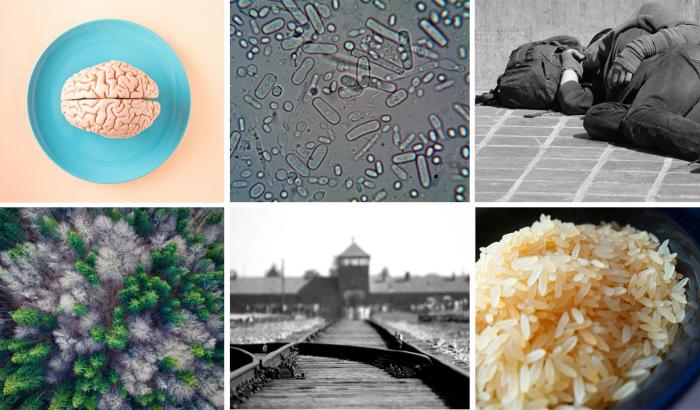Didier Hatz
Prof. Andreas Michels
In vielen Wissenschaften ist es von grundlegender Bedeutung, die internen Strukturen von Materialien genau zu verstehen und oftmals regelrecht zu „durchleuchten“. Zum Beispiel in der Chemie und Biologie, um Kristallstrukturen von Eiweißen und somit deren Funktionen zu verstehen. Oder in den Materialwissenschaften, um – nur ein Beispiel von vielen – zu verstehen, was Magnete besonders leistungsstark macht.
Einblick in innere Strukturen
Der Physiker Andreas Michels weiß, wie dieser Blick ins Innere der Materie gelingt: Er ist ein Experte für die sogenannte Neutronenstreutechnik; eine Technik, die es erlaubt, Strukturen zu untersuchen, die auf einer besonders interessanten Längenskala liegen: Im Bereich von ungefähr 1 Nanometer – was ungefähr dem Durchmesser eines DNA-Moleküls entspricht- bis zu einigen 100 oder sogar 1000 Nanometern – was einem Tausendstel bzw. einem Hundertstel eines Durchmessers eines menschlichen Haares entspricht. Einem Gröβenbereich, den man die mesoskopische Längenskala nennt und der außerordentlich wichtig ist, wie Michels betont: „Auf dieser Längenskala werden viele der Eigenschaften bestimmt, die man makroskopisch feststellen kann, etwa bei einem Permanentmagneten. Dessen Eigenschaften hängen davon ab, was auf der Mesoskala passiert. Wie groß sind die zwischen 10nm und 10µm großen Kristallite, also die kornartigen Bestandteile in Werkstoffen? Sind sie statistisch verteilt oder in bestimmter Weise angeordnet? Solche Aspekte bestimmen wesentlich die Eigenschaften des Magneten und lassen sich mit der Neutronenstreutechnik untersuchen“. Das ist sehr wichtig zu verstehen, denn: Kennen Forscher die Zusammenhänge zwischen Struktur und Eigenschaften eines Magneten, können sie dessen Leistungsstärke optimieren.
Eine genaue Methodenbeschreibung
Damit die Messungen und die Beschreibungen der Materialien verlässlich sind, braucht es allerdings ein sehr genaues Verständnis der Neutronenstreutechnik, die ausgesprochen komplex ist. Andreas Michels beschäftigt sich seit seiner Doktorarbeit, seit 24 Jahren, mit der Thematik und hat erst jüngst ein fast 400seitiges Buch veröffentlicht, das den Stand des heutigen Wissens zusammenfast. „Ich habe schon früh gemerkt, dass in der theoretischen Beschreibung dieser Technik viel im Argen liegt und einiges einfach fundamental falsch war. Das hat mich motiviert, dieses sehr dicke Brett zu bohren und Jahrzehnte in diese Forschung zu investieren“, erzählt der Forscher. Er erhielt 2010 einen ATTRACT Fellowship des Fonds National de la Recherche (FNR), mit dem er seine eigene Forschungsgruppe an der Universität Luxemburg aufbauen konnte.
Von der Theorie zur Anwendung
Andreas Michels sieht sich dabei nicht als Materialwissenschaftler, der den Ansatz verfolgen würde: Wie müssen wir das Material machen, damit diese oder jene Eigenschaft herauskommt? Für ihn sind die Materialien, mit denen er arbeitet das Mittel zum Zweck, um seine Methodik noch besser zu verstehen. Gleichwohl kommt die Methodik in einer Vielzahl von Techniken zur Anwendung, die immer wichtiger werden: So müssen die starken und teuren Neodym-Eisen-Bor-Magnete gut verstanden sein, bevor sie etwa in Elektroautos oder in Windkrafträdern zum Einsatz kommen. Zudem hilft die Optimierung seiner Methodik, auch neue Magnetklassen besser zu verstehen, die zwischen diesen teuren Magneten und den eher billigen Ferrit-Magneten (wie sie in Kühlschränken zum Einsatz kommen) verwendet werden: Mangan-Bismut-Magnete haben zum Beispiel das Potential, um diese Lücke zu schließen.
Autor: Tim Haarmann
Editor: Michèle Weber (FNR)
Foto: Didier Hatz
Infobox
In den 1960er Jahren hat man begonnen, magnetische Materialien, wie etwa Stähle, unter Verwendung von Neutronen anzugucken, dabei aber schlicht alte theoretische Konzepte aus der nicht-magnetischen Kleinwinkelstreuung übernommen. In vielen Fällen geht das; in vielen Fällen aber auch nicht. Andreas Michels und seinem Doktorvater war dieses Problem seinerzeit sehr bewusst und sie haben erkannt, dass es eine neue Beschreibungsweise für die magnetischen Aspekte der Kleinwinkelstreuung braucht. Deshalb ist er am Ball geblieben und sein neues Buch ist das Ergebnis dieser 25jährigen Arbeit von parallel Theorie, Experiment und Simulation.