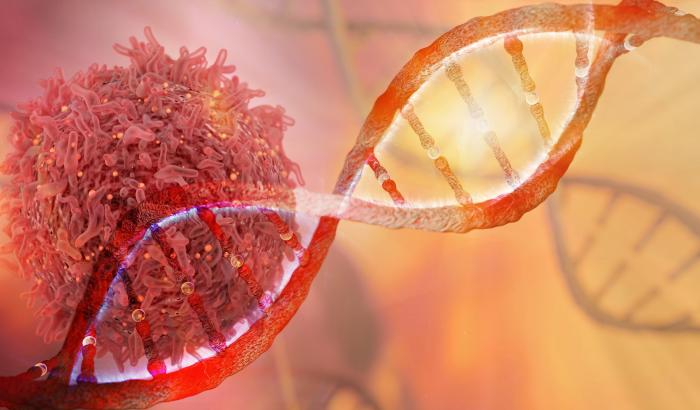CHL & AdobeStock/click_and_photo
links: Dr. Carine de Beaufort, Kinderendokrinologin am CHL. Rechts: Kind mit Diabetes, das eine Insulinpumpe installiert bekommt.
Am 14. November ist Weltdiabetes-Tag. Auch dieses Jahr liefert der Atlas der International Diabetes Federation (IDF) alarmierende Zahlen. Schätzungsweise jeder neunte Erwachsene weltweit lebte 2024 mit Diabetes, der Großteil davon mit Typ-2-Diabetes. Über 3,4 Millionen Menschen starben an den Folgen der Stoffwechselkrankheit. Diese Zahlen steigen kontinuierlich an und machen Diabetes zu einer der am schnellsten wachsenden Gesundheitsherausforderungen des Jahrhunderts. Das gilt auch für Luxemburg. Prognosen sagen bis 2050 bis zu 44 000 Betroffene voraus. Schon heute hat Luxemburg laut IDF die fünfthöchsten diabetesbedingten Gesundheitsausgaben pro Person weltweit. Wir sprachen mit Prof. Dr. Carine De Beaufort, Kinderärztin an der CHL-Kannerklinik, Diabetes-Expertin und Forscherin über aktuelle und zukünftige Therapien, den Krankheitsstress und die Bedeutung von Bewegung und Ballaststoffen.
Infobox
Vor gut hundert Jahren entdeckten Forscher Insulin, ein lebenswichtiges Hormon, das in der Bauchspeicheldrüse hergestellt wird. Insulin reguliert den Blutzuckerspiegel, indem es Glukose (Zucker) aus dem Blut in die Körperzellen schleust, wo sie als Energie genutzt oder gespeichert werden kann. Ohne ausreichendes oder wirksames Insulin steigt der Blutzuckerspiegel dauerhaft an – und das passiert bei Diabetes mellitus (vom lateinischen „mellitus“ - „honigsüß“) aufgrund eines Insulinmangels oder einer Insulinresistenz. Die Krankheit ist chronisch und erfordert meist lebenslange Aufmerksamkeit und Behandlung.
Symptome und Risiken: Typisch sind ständiger Durst, vermehrtes Wasserlassen, Gewichtsverlust, Müdigkeit, Sehstörungen oder Infektionen. Die Stoffwechselerkrankung ist chronisch und kann unbehandelt Blutgefäße und Organe schädigen sowie zu Komplikationen wie Herzinfarkt, Nierenschwäche, Erblindung und Amputationen der unteren Gliedmaßen führen.
Typ-1-Diabetes ist eine nicht heilbare Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem die insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse zerstört. Sie tritt oft schon früh im Leben auf, bei Kindern und jungen Erwachsenen (< 40) und macht weniger als 10% aller Diabetes-Fälle aus. Betroffene leiden unter einem echten Insulinmangel und müssen deshalb lebenslang Insulin spritzen. Das betrifft in Luxemburg etwa 2400 Menschen. Die genauen Ursachen sind unbekannt, vermutlich eine Kombination aus genetischer Veranlagung und Umweltfaktoren.
Beim häufigeren Typ-2-Diabetes ist der Zuckerstoffwechsel gestört. Die Zellen in Muskeln, Fettgewebe und Leber reagieren weniger empfindlich auf Insulin. Aufgrund dieser verminderten Reaktionsfähigkeit muss immer mehr Insulin ausgeschüttet werden, bis die Betazellen erschöpft sind. Diese Diabetes-Form macht rund 90 Prozent aller Fälle aus und wird oft durch Übergewicht und zu viel Bauchfett, Bewegungsmangel und eine ungesunde Ernährung begünstigt. Weitere Risikofaktoren sind Bluthochdruck und enge Verwandte mit Typ-2-Diabetes.
Typ-2-Diabetes kann über Jahre hinweg unbemerkt bleiben, bevor es zu Komplikationen kommt. Vier von zehn Betroffenen wissen laut IDF nicht, dass sie an der Krankheit leiden. In Luxemburg gibt es über 30 000 Personen mit Typ-2-Diabetes, darunter zunehmend mehr Kinder und Jugendliche. Zur Behandlung gehören gesunde Ernährung und Bewegung, Medikamente, wenn nötig auch Insulin. Bei konsequenter Änderung des Lebensstils kann sich der Blutzucker normalisieren, doch Veranlagung und Rückkehrrisiko bleiben. Auch wenn zunehmend Kinder und jüngere Menschen Typ-2-Diabetes entwickeln, nimmt das Erkrankungsrisiko mit dem Alter (ab etwa 45 Jahren) zu. Teste dein Risiko für Typ-2-Diabetes auf der Internetseite des Gesundheitsministeriums.
Darüber hinaus gibt es weitere, sehr seltene Formen von Diabetes, die durch Gendefekte oder andere Erkrankungen ausgelöst und oft als Typ3-Diabetes bezeichnet werden. Außerdem kann im Zuge einer Schwangerschaft Diabetes bei der werdenden Mutter auftreten (Schwangerschaftsdiabetes).
Die Zahl der Diabetes-Fälle steigt weltweit. Was beobachten Sie in Luxemburg?
Carine De Beaufort: Als ich 1987 begann, an der KannerKlinik zu praktizieren, sah ich pro Jahr etwa neun neue Fälle von Kindern zwischen null und 14 Jahren mit Typ-1-Diabetes. Jetzt sind es 35 neu diagnostizierte Fälle von null bis 18 Jahren, und die Zahlen steigen jedes Jahr um zwei bis drei Prozent. Typ-2-Diabetes entwickelt sich eher schleichend und betrifft vor allem Erwachsene, doch wir sehen heute auch Kinder und Jugendlichen mit Typ-2, und bei ihnen zeigt sich die Krankheit oft deutlich aggressiver. Typ-2 nimmt wegen der zunehmenden Zahl von übergewichtigen Menschen weiter zu, in den Industrienationen wie auch in ärmeren Ländern. Heute zählt Diabetes weltweit zu den zehn Krankheiten mit der höchsten Sterblichkeit.
Welche Missverständnisse über Diabetes begegnen Ihnen in medizinischem Alltag und Öffentlichkeit?
Typ-1 und Typ-2 werden oft verwechselt, dabei haben sie sehr unterschiedliche Ursachen. Typ-1 ist autoimmunbedingt, der Körper produziert kein Insulin mehr. Typ-2 ist stoffwechselbedingt und es liegt eine (erworbene) Insulinresistenz vor. Manche Menschen meinen fälschlicherweise, Diabetes sei ansteckend. Andere fallen auf falsche Heilsversprechen dubioser Zentren herein. Viele Menschen unterschätzen die gefährlichen Langzeitfolgen von Diabetes wie Herzinfarkt oder Erblindung. Vor allem aber können sich Gesunde nur schwer vorstellen, was für eine psychische Belastung Diabetes für Betroffene darstellt.
Es ist nicht leicht, mit Typ-1-Diabetes zu leben, denn die Krankheit erfordert ein enormes Maß an Disziplin. Man muss ständig überwachen, was und wieviel man isst, das dafür nötige Insulin berechnen und sich selbst verabreichen, um den Blutzucker in Balance zu halten und keine Symptome zu riskieren. Menschen mit Typ-1-Diabetes haben niemals Urlaub von ihrer Krankheit. Denken sie nicht an ihre Krankheit, dann denkt die Krankheit an sie. Das ist eine große Belastung. Psychologische Unterstützung ist besonders für Kinder deshalb ein wichtiger Teil der Therapie.
Stressfaktor Diabetes-Management
Wissenschaftler Luxemburger Forschungsinstitute und der KannerKlinik forschen in mehreren Projekten daran, wie innovative Lösungen den Stress des Diabetes-Managements reduzieren können. So beobachteten Pflegekräfte einer Studie der KannerKlinik und des LUCET der Universität zufolge bei kleinen Kindern eine bessere Lebensqualität, wenn sie automatische Insulinverabreichungssysteme – eine Kombination aus Glukosesensor, Insulinpumpe und Algorithmus zur Berechnung der Insulinabgabe – erhielten. In einem anderen Projekt testen Forscher des Luxembourg Institute of Health (LIH) digitale Interventionen zur Verbesserung des Diabetesmanagements, die den Stress von Menschen mit Diabetes an der Stimme erkennen. Ziel ist es, ein Fernüberwachungsgerät zu entwickeln, das das psychologische Wohlbefinden eines Patienten beurteilen kann.
Was sind derzeit die wirksamsten Behandlungsmöglichkeiten zur Kontrolle von Diabetes?
Weder Typ-1 noch Typ-2 sind leicht zu behandelnde Krankheiten. Über hundert Jahre nach Entdeckung des Insulins ist die Insulintherapie, kombiniert mit Selbstmanagement und gesunder Lebensweise, für Menschen mit Typ-1-Diabetes nach wie vor Grundlage der Behandlung. Der klassische Pieks in den Finger, um den Blutzuckerwert zu messen, und die Insulinspritze oder der Insulin-Pen ins Bauchfett gibt es zwar immer noch. Aber die Technik hat sich stark weiterentwickelt, und die Verabreichung ist viel leichter geworden.
Viele Personen mit Diabetes können ihren Blutzucker heute mithilfe von kleinen Sensoren auf der Haut messen. Automatische Insulin-Dosierungs-Systeme kombinieren dieses kontinuierliche Glukosemessgerät mit einer Pumpe, die Insulin über einen Katheter ins Unterhautfettgewebe abgibt. Sensor und Pumpe kommunizieren mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz miteinander – wie eine Art künstliche Bauchspeicheldrüse. Die Werte werden per App auf Pumpe oder Smartphone angezeigt. Der Algorithmus berechnet die nötige Insulinabgabe, gleicht so die Blutzuckerschwankungen aus, und der Betroffene kann ruhig schlafen. Das ist ein gewaltiger Fortschritt.
Leider haben nicht alle Menschen mit Diabetes weltweit Zugang zu diesen Technologien – sei es aus Kostengründen oder wegen der individuellen Eignung. In Luxemburg ist modernste Medizintechnik zum Glück verfügbar. Die KannerKlinik gehörte zu den Pionieren solcher automatischen Systeme bei Kindern und setzt sie erfolgreich ein. Gerade Kinder finden die Therapie via App richtig cool und sind hochmotiviert. Das funktioniert so gut, dass sie oft seltener zur Kontrolle kommen müssen und der Familienalltag leichter wird.
Die vielversprechendste Strategie bei Typ-2-Diabetes ist ganz klar ein gesunder Lebensstil. Ich kann es nicht oft genug sagen.
Dr. Carine de Beaufort
Welche Rolle spielt der Zuckerkonsum?
Bei Typ-1-Diabetes ist ein Mangel an Insulin durch eine Autoimmunerkrankung die Ursache, bei der Zucker keine direkte Rolle spielt. Anders sieht es aus bei der Entstehung von Typ-2-Diabetes. Denn wer zuckerhaltige Lebensmittel und Getränke wie Süßigkeiten, Limonaden oder Fertiggerichte im Übermaß konsumiert, riskiert Übergewicht und einen dauerhaft erhöhten Blutzucker- und Insulinspiegel. Das kann die Körperzellen resistent gegen Insulin machen, die Bauchspeicheldrüse überlasten und zu Typ-2-Diabetes führen.
Gibt es nicht-insulinbasierte Medikamente oder Strategien, die vielversprechend sind?
Bei Typ-2-Diabetes erhalten neun von zehn Erwachsenen nach der Diagnose blutzuckerregulierende Medikamente. Bei einer konsequenten Umstellung des Lebensstils benötigen sie eventuell weniger. Die vielversprechendste Strategie bei Typ-2-Diabetes sind ganz klar ein gesunder Lebensstil und körperliche Bewegung. Ich kann es nicht oft genug sagen. Unsere Gene haben sich an die Überflussgesellschaft noch nicht angepasst. Wir nehmen bei zu großem Nahrungsmittelangebot, kombiniert mit zu wenig Ballaststoffen im Essen, unwillkürlich zu.
Übergewicht wiederum ist ein großer Risikofaktor, um Typ-2-Diabetes zu entwickeln. Für Manche kommt auch eine operative Verkleinerung des Magens in Betracht. Für die Therapie aller Menschen mit Diabetes gilt, dass der Mix an Medikamenten personalisiert und an den Patienten individuell angepasst wird – mit dem Ziel, den Blutzucker zu normalisieren. Wenn dies nicht gelingt, muss Insulin verabreicht werden.
Was ist mit „Abnehmspritzen“ wie Ozempic?
Abnehmspritzen verschiedener Hersteller sind für Typ-2-Diabetiker in der Tat ein vielversprechender Weg, Übergewicht zu reduzieren und den Zuckerstoffwechsel zu verbessern. Die neueste Generation dieser Medikamente gibt es sogar schon als Tabletten. Bei manchen Jugendlichen scheinen Abnehmmedikamente leider etwas weniger zu wirken. Wichtig ist, dass die Nutzer sportlich aktiv bleiben und keine Muskelmasse verlieren.
Ozempic – die Abnehmspritze
Das Medikament Ozempic, bekannt als „Abnehmspritze“, wurde ursprünglich für Typ-2-Diabetes entwickelt und ist aktuell in Luxemburg auch nur für die Behandlung dieser Form von Diabetes zugelassen. Ozempic wirkt hier auf verschiedene Weise:
- Ozempic enthält den Wirkstoff Semaglutid. Semaglutid ahmt ein Hormon namens GLP-1 nach, das bei gesunden Menschen die Freisetzung von Insulin reguliert. Bei Personen mit Diabetes funktioniert diese Freisetzung nicht mehr richtig. Ozempic bzw. Semaglutid stimuliert die Bauchspeicheldrüse, nach dem Essen mehr Insulin freizusetzen – also dann, wenn man es braucht, um den Blutzuckerspiegel wieder zu senken.
- Semaglutid hilft außerdem, die Produktion von Glukagon zu reduzieren – ein Hormon, das die Leber anregt, Glukose (Zucker) freizusetzen. Dadurch wird der Blutzuckerspiegel ebenfalls gesenkt.
- Das Medikament bewirkt auch, dass Essen langsamer vom Magen in den Dünndarm geleitet wird. Auch dadurch wird der Blutzuckerspiegel nach dem Essen stabilisiert. Außerdem entsteht ein Sättigungsgefühl, das lange anhält - mit dem Ergebnis, dass man auch ohne Diabetes weniger Hunger hat und weniger isst. Deshalb wird das Medikament auch von Menschen ohne Diabetes genutzt, was zu Lieferengpässen geführt hat. Für Übergewichtige gibt es aber die Alternative Wegovy – eine Spritze, die den gleichen Wirkstoff wie Ozempic enthält.
Ozempic wird einmal pro Woche gespritzt. Wie alle Medikamente, hat Ozempic auch Nebenwirkungen. Deshalb ist es wichtig, mit seinem Arzt zu klären, ob Ozempic für die Behandlung geeignet ist.
Was sind derzeit die spannendsten Entwicklungen in der Diabetesforschung?
Beim Typ-1-Diabetes konzentrieren sich viele Forschungsprojekte auf die Früherkennung der Krankheit in den Phasen, bevor sich klinische Symptome zeigen und es zu schweren Stoffwechselproblemen kommt. Ziel ist, die Autoimmunreaktion - und damit die Zerstörung der insulinproduzierenden Betazellen in der Bauchspeicheldrüse - zu stoppen oder hinauszuzögern. Diese Zerstörung wird durch Autoantikörper ausgelöst, die der Körper gegen seine eigenen Betazellen bildet. Solche Autoantikörper sind oft schon Jahre vor Ausbruch von Typ-1-Diabetes nachweisbar. Es gibt mehrere Screening-Programme in Europa, die die Bevölkerung bereits auf Autoimmunkrankheiten und Antikörper testen.
Große Hoffnungen liegen auf Medikamenten, die das Immunsystem beeinflussen und Autoimmunangriffe abschwächen. Als vielversprechend gilt das Herzmedikament Verapamil, das bei Menschen mit Typ-1-Diabetes die Betazellen schützen kann. US-Studien haben seinen Effekt nachgewiesen. In den USA ist der Immunmodulator Teplizumab bereits zugelassen, um bei manchen Menschen mit Typ-1-Diabetes im Stadium 2 den klinischen Ausbruch um etwa zwei Jahre zu verzögern. In Europa wurde ein Antrag auf Zulassung eingereicht.
Mindestens zehn weitere Medikamente sind in der Pipeline, um bei Typ-1-Diabetes das Fortschreiten von Stadium 2 zum klinischen Stadium 3 zu verzögern. Ebenfalls in der Entwicklung sind Impfungen, die das Immunsystem „tolerant“ gegen die Immunattacken gegen die Betazellen machen sollen. Tolerant machen heißt, dass der Körper seine eigenen Betazellen nicht mehr als schädlich ansieht und nicht mehr versucht, sie zu zerstören.
Wie steht es um die Stammzellentherapie?
Stammzellentherapie könnte eine echte Heilung ohne lebenslange Insulingabe möglich machen. Dabei werden neue Betazellen aus Stammzellen von Spendern im Labor gezüchtet und dann in den Patienten implantiert. So können wieder Insulin-produzierende Zellen entstehen. Erste Studien in China und den USA haben gezeigt, dass Patienten so teilweise wieder eigenes Insulin produzieren können. Doch die große Herausforderung ist, dass der Körper die implantierten Zellen abstößt und deshalb lebenslang Immunsuppressiva braucht – also Medikamente, die das Immunsystem schwächen und Patienten somit beispielsweise anfälliger für Infektionen machen.
Vor kurzem erschien eine schwedisch-amerikanische Studie, bei der die Stammzellen in den Körper eingeschleust wurden, was Immunsuppressiva unnötig machen soll. Bei dieser weltweit ersten Transplantation genetisch veränderter Pankreasinselzellen gewann ein Patient die Fähigkeit zurück, auf natürliche Weise Insulin zu produzieren ohne eine Abstoßung zu verursachen . Das ist alles noch im experimentellen Stadium, zeigt aber, dass fortschrittliche Stammzelltherapie für Typ-1-Diabetes ein vielversprechender Ansatz ist. Ich bin zuversichtlich, dass diese Therapie kommt.
Und was sind die Perspektiven bei der viel häufigeren Typ-2-Diabetes?
Neben verbesserten Abnehmspritzen und -tabletten sind neue, besser verträgliche Medikamente in der Entwicklung. Daneben gerät nicht nur bei Typ-1, sondern auch bei Typ-2-Diabetes das Darmmikrobiom immer mehr in den Fokus der Forschung, also die Gesamtheit der Mikroben im Verdauungstrakt. Das Mikrobiom beeinflusst in den ersten Lebensjahren die Reifung des Immunsystems und damit möglicherweise das Risiko für Autoimmunkrankheiten, später dann Stoffwechsel und Insulinempfindlichkeit.
Bei Menschen mit Typ-2-Diabetes wird oft ein verändertes, weniger vielfältiges Mikrobiom gefunden. Hier hilft ballaststoffreiche Ernährung, die „guten“ Bakterien zu vermehren, die den Blutzuckerstoffwechsel verbessern. Bei einer Studie in Amsterdam mit Transplantationen von Stuhl gesunder Spender wurden Erwachsene mit Typ-2-Diabetes zumindest für kurze Zeit wieder insulinsensitiver. Die Forschung braucht allerdings dringend weltweit vergleichbare Daten, um Erkenntnisse besser bewerten zu können.
Gilt das auch für Luxemburg?
In Luxemburg brauchen wir ein Diabetes-Register mit allen Fällen, nicht nur denen im Kindesalter, damit wir analysieren können, welche Therapien und Technologien tatsächlich langfristig wirken. Die Zunahme nicht übertragbarer Krankheiten wie Typ-1-Diabetes, Adipositas und Allergien bei Kindern deutet auf eine Schlüsselrolle von Umweltrisikofaktoren hin, die möglicherweise durch das Mikrobiom vermittelt werden. Für eine gesunde zukünftige Generation hat die Forschung in der frühen Lebensphase deshalb hohe Priorität.
Unser zentrales Anliegen ist die Verbesserung der Lebensqualität von Kindern mit Diabetes und ihren Familien durch innovative Technologien und ein besseres Verständnis der Ursachen von Diabetes. Dies ist nur durch die Zusammenarbeit mit nationalen Einrichtungen wie dem LCSB, dem LIH, Kollegen der Kinderklinik und internationalen Kooperationspartnern möglich.
Wichtig wäre es auch, alle übergewichtigen jungen Menschen konsequent auf ihr Typ-2-Diabetesrisiko zu testen. Ohne wissenschaftlichen Ansatz, der auf harten Fakten beruht, können wir unsere Erfahrungen nicht absichern, Trends und Sterblichkeit nicht berechnen. Das alles kann aber auf Gesundheitspolitik und Therapien der Zukunft einen großen Einfluss haben.
Zuckerverbote oder Steuern auf besonders ungesunden Produkten – es gibt viele Optionen. Der Körper gewöhnt sich in nur zehn Tagen an einen weniger süßen Geschmack.
Dr. Carine de Beaufort
Typ-2-Diabetes ist die mit Abstand häufigste Form der Krankheit und nimmt auch bei jungen Menschen zu. Was wird zur Vorbeugung getan?
Trotz großer öffentlicher Kampagnen wie „Gesond iessen, méi bewegen“ und der Zusammenarbeit der Krankenhäuser und Forscher mit der Schulmedizin müssen wir uns eingestehen, dass dies nicht reicht. Als Gesellschaft müssen wir uns dringend mehr auf die Gesundheit von Kindern konzentrieren, denn Fettzellen entwickeln sich im frühen Kindesalter. Die wichtige Rolle regelmäßiger körperlicher Bewegung wird noch immer unterschätzt. Vergleichsstudien in Kindergärten haben klar belegt, dass täglich 30 Minuten Bewegung den Body-Mass-Index und damit die Risiken für späteres Übergewicht und Typ-2-Diabetes reduzieren. Doch wenn beide Eltern voll berufstätig sind und Familien kaum noch Zeit fürs Kochen und für Bewegung bleibt, haben wir ein massives gesellschaftliches Problem.
Noch kein europäisches Land hat in Sachen Ernährungserziehung „best practices“ vorzuweisen, um junge Generationen nachhaltig zu gesundem Essen zu bringen. Zuckerverbote, wie vom ehemaligen Gesundheitsminister Mars di Bartolomeo angeregt, Steuern auf besonders ungesunde Produkte – es gibt viele Optionen. Wichtig ist, die ganze Familie mit einzubeziehen, und die Schulen. Nicht, indem man einmal im Jahr einen Starkoch in die Klassen schickt, sondern durch dauerhaft mehr Ballaststoffe im Schulkantinenessen. Der Körper gewöhnt sich in nur zehn Tagen an einen weniger süßen Geschmack.
Autorin: Britta Schlüter
Redaktion: Michèle Weber (FNR)