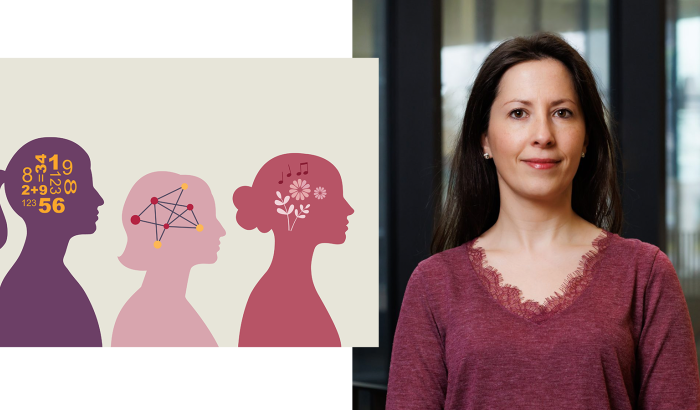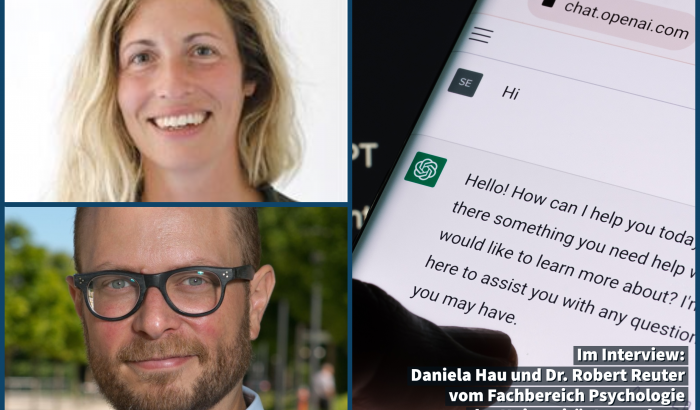© Uwe Hentschel
Antoine Fischbach ist Professor für pädagogische und psychologische Messung an der Uni Luxemburg und Leiter des Luxembourg Centre for Educational Testing (LUCET)
Die alle drei Jahre präsentierten Ergebnisse der Pisa-Studie sind für Luxemburg in der Regel kein Grund für Freudensprünge. Und daran ändern auch die Resultate des aktuellen Bildungsvergleichs nichts. In allen drei Bereichen (Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissenschaften) schneidet Luxemburg schlechter ab als der OECD-Durchschnitt. Antoine Fischbach, Professor für pädagogische und psychologische Messung an der Uni Luxemburg und Leiter des Luxembourg Centre for Educational Testing (LUCET) beobachtet und erforscht die Entwicklung seit Jahren.
Antoine, haben dich die Ergebnisse der aktuellen Pisa-Studie in irgendeiner Form überrascht?
Nein, gar nicht. Für mich ist es das gleiche Bild, wie wir es seit knapp 20 Jahren sehen. Wir haben im Anschluss an die letzte Studie vor drei Jahren versucht, nach 15 Jahren Pisa eine Bilanz zu ziehen. Und die Erkenntnisse von damals treffen auch heute noch zu.
Wo liegt bei den luxemburgischen Schülern das Problem?
Wir haben erstens ein generelles Leistungsproblem, das sich durch alle Bereiche zieht und das sich in erster Linie damit erklären lässt, dass wir extreme Disparitäten zwischen unterschiedlichen Subgruppen im Land haben. Das gibt es überall, aber nirgendwo sonst ist die Verbindung zwischen dem sozioökonomischen Hintergrund und dem Einfluss auf die Leistung so ausgeprägt wie in Luxemburg. Im Bereich der Lesekompetenz liegen bei uns beispielsweise 122 Punkte zwischen dem oberen und dem unteren sozioökonomischen Quartil.
122 Punkte Unterschied – was bedeutet das?
Über den Daumen gerechnet kann man sagen, dass ein Jahr Beschulung ungefähr 40 Pisa-Punkte ausmacht. Das heißt, dass bei den Leistungen zwischen den 15-Jährigen aus der oberen und denen aus der unteren sozioökonomischen Schicht quasi drei Schuljahre liegen. Und dieser Unterschied ist bei Schülern, die gerade mal 15 sind, schon enorm.
Wie lassen sich die extremen Ungleichheiten erklären?
Diese Disparitäten sind zum Teil darauf zurückzuführen, dass wir eine hochgradig diverse Schülerschaft haben, die in diesem Maße tatsächlich einmalig ist. Allerdings muss man auch sagen, dass wir trotz allem eine relative Stabilität haben. Bis 2015 konnte man in keinem Bereich von einem Pisa-Trend für Luxemburg sprechen.
Interessent wäre jetzt sehen, wie es weitergeht, ob sich da ein Negativ-Trend ankündigt oder ob es weiterhin als Fluktuation, also eine relative Stabilität, verbucht werden kann. Letztlich ist das aber nur ein Teilerfolg, der nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass wir uns bei der soziodemographischen Zusammensetzung der Schülerschaft in einem Eiltempo in eine Richtung entwickelt haben, bei der man eigentlich sogar einen stetigen Abfall hätte erwarten müssen. Möglicherweise steht uns das noch bevor.
Der größte Ungerechtigkeitsfaktor ist also der sozioökonomische Status?
Genau. Und der hängt natürlich eng zusammen mit der Sprache, die zu Hause gesprochen wird, und natürlich mit dem Migrationshintergrund. Und den haben inzwischen 55 Prozent der luxemburgischen Pisa-Schüler.
Bei der Präsentation der Ergebnisse in Luxemburg wurde auch angeregt, sich zukünftig eher mit Ländern zu vergleichen, die ein ähnliches Profil wie Luxemburg aufweisen. Wäre das sinnvoller?
Solche Diskussionen gibt es ja bereits seit ein paar Jahren. Natürlich: Wenn man sich die Rankings anschaut, kann man sich natürlich schon fragen, was hat Luxemburg mit Shanghai zu tun? Aber es nehmen ja auch europäische Nachbarländer teil. Von daher finde ich diese beliebte Fokussierung auf Shanghai oder andere Regionen Chinas immer sehr speziell.
Die Frage sollte deshalb eher lauten: Was bringt uns Pisa? Es geht doch darum, einen Bildungsdialog zu versachlichen, der bis dahin nur meinungsbasiert war. Bis 2001, als die Ergebnisse der 2000er-Studie herauskamen, gab es in Luxemburg keine belastbaren Daten über die Bildungslandschaft, sondern es wurde nach bestem Wissen und Gewissen gesteuert.
Irgendwie hat sich sehr hartnäckig das Bild gehalten, dass Bildungserfolg, überhaupt Pädagogik, kunstvolles Handeln ist, das sich nicht quantifizieren lässt. Diesen Bildungsdialog zu versachlichen und auf Daten zu stützen, ist meiner Ansicht nach für Luxemburg der größte Mehrwert. Und der wird durch diese Studie erreicht. Pisa bildet Bildungstrends ab. Und die Studie zeigt uns, ob die Ziele, die wir uns als Land gesetzt haben, vielleicht zu hoch oder zu niedrig sind.
Wie repräsentativ ist diese Studie?
Die Pisa-Studie ist mit Sicherheit nicht perfekt, aber sie ist trotz allem State of the Art und besser als jede andere Studie. Es wird ja durchaus immer kritisiert, dass in Luxemburg eine Vollerhebung mit fast allen Schülern stattfindet und in anderen, größeren ändern die Erhebung nur mit einem Teil der Schüler durchgezogen wird. Dieser Kritik kann ich mich nicht anschließen. Zum einen glaube ich nicht, dass Teilnehmer-Länder schummeln, zumal es ja auch eine sehr starke Peer-Kontrolle gibt. Zum anderen ist es ja auch nicht so, dass hierzulande jeder 15-Jährige mitmacht. Bei uns gibt es die gleichen Ausschusskriterien wie in allen anderen Ländern. Und die kommen beispielsweise bei Schülern mit besonderen Bedürfnissen zum Tragen.
Was nach außen hin oder an Stammtischen oft als große Ungerechtigkeit für Luxemburg interpretiert wird, ist eigentlich eine große Chance für uns. Dadurch, dass wir annähernd mit einer Vollerhebung mitmachen, sind unsere Resultate, dank der kleineren statistischen Standardfehler, letztlich auch viel genauer als die in anderen Ländern.
In Luxemburg wird aber auch kritisiert, dass eine Teilnahme an der Pisa-Studie zwar in Deutsch und Französisch möglich ist, aber nicht in Luxemburgisch…
Das stimmt. Aber da muss ich sagen: Historisch und politisch gesehen ist Luxemburgisch zweifelsohne eine eigene Sprache, linguistisch gesehen aber nur ein Dialekt, der auch nicht weiter vom Hochdeutschen entfernt ist als so manch anderer Dialekt. Zudem werden die Schüler ja auf deutsch alphabetisiert. Außerdem kann man sich ja aussuchen, in welcher der beiden anderen Sprachen man den Test machen möchte.
Ideal wäre hierbei sicherlich, wenn man in den einzelnen Bereichen frei wählen könnte, die Lesebögen also beispielsweise auf Deutsch und die Bögen für Mathe dafür dann auf Französisch machen könnte. Das ist leider noch nicht möglich. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass wir bei der Pisa-Studie in 2009 an einem zweiten Testtag die Schüler ähnliche Lesetests in der jeweils anderen Sprache haben machen lassen. Und das Ergebnis war recht ernüchternd. Von daher ist auch diese Kritik meines Erachtens nicht berechtigt.
Die Studie ist also gut, aber nicht perfekt. Woran hakt es?
Der Punkt ist der, dass man bei der Studie 2015 größere methodische Veränderungen eingeführt hat. Man ist auch von papier- auf computerbasiertes Testen umgestiegen. Und das hat einen Vergleich mit den Ergebnissen vorheriger Studien erschwert. Für mich gibt es deshalb ein Pisa bis 2012 und ein Pisa ab 2015. Dadurch, dass man auf Computer umgestiegen ist, wurde auch das neue Format ausgereizt, was an sich ja kein Problem ist. Aber man verändert das Konstrukt, indem man beispielsweise in den Naturwissenschaften Sachen misst, die vorher auf dem Papier nicht möglich waren. Es gab viele substanzielle Veränderungen und Innovationen, die für mich auch nicht alle nachvollziehbar sind. Insbesondere, wenn eigentlich die Devise „If you want to measure change, don’t change the measure“ lauten müsste. Man muss also aufpassen, dass Pisa nicht zum Selbstzweck wird.
Die Pisa-Studie wird alle drei Jahre durchgeführt. Lassen sich denn Erfolge durch Veränderungen beziehungsweise Verbesserungen im Bildungsbereich in diesem kurzen Zeitraum überhaupt messen?
Das ist der Punkt. Diese drei Jahre sind komplett unrealistisch, um strukturelle Veränderungen in einem Schulsystem zu erfassen. Von daher reicht es meiner Meinung auch, wenn wir nur alle sechs Jahre an der Studie teilnehmen. Wenn man – was in unserem Fall erforderlich ist - ein Schulsystem von Grund auf drehen möchte, dann spricht man von Jahrzehnten. In der Öffentlichkeit und in den Medien wird ein sehr negatives Bild vermittelt, wenn alle drei Jahre der Pisa-Hammer kommt. Dabei glaube ich, dass Pisa sehr viel Konstruktives im Land angestoßen hat.
Und wie geht man damit um?
Die Schlussfolgerungen sind immer die gleichen. Das Problem ist hausgemacht. Wie haben seit jeher ein System, das sehr schlecht mit der Heterogenität umgeht. Und das weiß man auch schon seit der ersten nationalen Bildungsstudie MAGRIP von 1968. Aber wir haben uns seitdem demographisch extrem und auch extrem schnell verändert. Wir müssen uns zum einen überlegen, wie wir diese Heterogenität besser in den Griff bekommen, und zum zweiten, wie wir flexibler mit unserer Sprache umgehen.
Wir müssen davon weg, dass jeder, der durch unser Schulsystem geht, am Ende mindestens trilingual perfekt ausgestattet sein muss. Im Vergleich zum Ausland ist dieser Anspruch horrend. Natürlich ist Multilingualismus etwas ganz Wundervolles. Es ist eine Chance, darf aber keine Hürde sein. Viele Kinder wären besser aufgestellt, wenn das Sprachsystem etwas flexibler wäre. Ich denke, da müsste man die Sprachansprüche etwas überdenken.
Interview: Uwe Hentschel