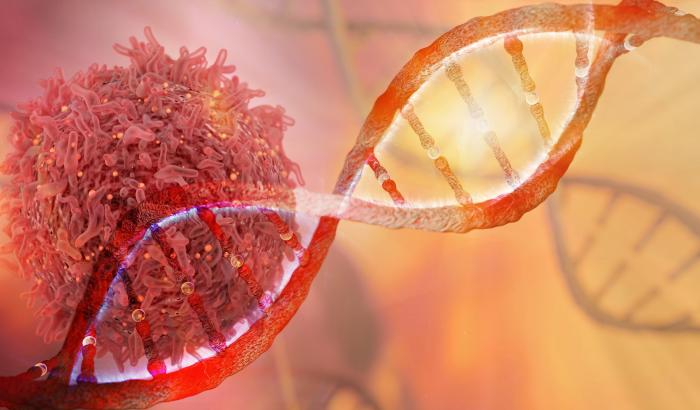Adobe Stock/wladimir1804
Parkinson-Patienten benötigen viele Disziplinen zur Behandlung.
Über 3000 Menschen leben in Luxemburg mit der Diagnose Parkinson, rund 150 Expertinnen und Experten forschen hierzulande zu der Krankheit. Wo Therapie und Forschung heute stehen und wie Luxemburgs Forschungsaktivitäten Patienten konkret zugute kommen, erklären die Neurowissenschaftlerin Prof. Dr. Anne Grünewald und der Clinician Scientist (Neurologe und Neurowissenschaftler) Prof. Dr. Rejko Krüger.
Anne Grünewald leitet ein Forschungslabor am Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB) der Universität Luxemburg und Rejko Krüger ist Professor für Neurowissenschaften am LCSB, medizinischer Koordinator des ParkinsonNet am Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) sowie des „National Centre for Excellence in Research on Parkinson’s disease“ (NCER-PD) am Luxembourg Institute of Health (LIH).


Links: Anne Grünewald; Rechts: Rejko Krüger.
Zitternde Hände sind ein typisches Parkinson-Symptom, können aber auch andere Ursachen haben. Wie stellt ein Arzt die Parkinson-Diagnose?
RK: Die heutige Diagnose basiert auf der körperlichen Untersuchung durch einen erfahrenen Neurologen und Spezialisten für Bewegungsstörungen. Am deutlichsten zeigt sich die Parkinson-Krankheit in der Tat durch Bewegungsstörungen wie dem Zittern, steifen Muskeln, Langsamkeit beim Gehen oder Wandern sowie Instabilität, also einer vermehrten Neigung zu Stürzen. Andere Symptome, die man als Laie nicht mit Parkinson in Verbindung brächte, komplettieren das Bild. Dazu zählen chronische Verstopfung, Riech- und Schlafstörungen.
Parkinson ist also mehr als eine Bewegungsstörung?
RK: Genau. Rund 30 Prozent der Betroffenen haben zum Zeitpunkt der Diagnose auch eine leichte Gedächtnisstörung, 80 Prozent entwickeln diese im Laufe der Krankheit. Parkinson ist eine komplexe Erkrankung und kein rein motorisches Problem.
Wie alt sind Menschen bei der Diagnose, und wie lange kann man damit leben?
RK: Parkinson ist eine Erkrankung des höheren Lebensalters. Ich habe zwar schon 20-Jährige diagnostiziert, aber typischerweise zeigen sich die Symptome nach dem 60. Lebensjahr. Männer sind etwas häufiger betroffen als Frauen. Doch ich möchte betonen: Sofern Parkinson von der Diagnose an gut behandelt wird, ist die Lebenserwartung nicht eingeschränkt. Manche Patienten neigen Studien zufolge dazu, verschriebene Medikamente nicht einzunehmen und sie „für später“ aufzuheben, wenn die Krankheit weiter fortgeschritten ist – aus Sorge, die Medikamente könnten sonst nicht mehr wirken. Davon rate ich ab. Patienten sollten rechtzeitig die richtige Therapie in der richtigen Dosis in Anspruch nehmen, um keine Komplikationen wie falsche Bewegungsmuster bis hin zu Stürzen zu riskieren, die die Lebenserwartung verringern könnten. Sie werden im Krankheitsverlauf nie „austherapiert“ sein. Bei Parkinson gibt es immer noch Behandlungsmöglichkeiten.
Luxemburger Forscher haben 2023 zusammen mit Kollegen der japanischen Juntendo-Universität den Grundstein für einen Test zur Erkennung von Parkinson im Blut entwickelt. Nutzen Ärzte dies schon?
RK: Der Bluttest ist in der Entwicklung, aber noch kein Standard in den Arztpraxen. Standard ist es aber, bei einer früh diagnostizierten Parkinson-Krankheit vor dem 50. Lebensjahr oder einer auffälligen Familienanamnese zur Bestätigung der Diagnose einen Gentest zu machen. So kann man sicher feststellen, ob der Betroffene zur seltenen Untergruppe von Parkinson-Patienten mit einer bestimmten Genmutation zählt. Das qualifiziert schon für klinische Studien, die versuchen, die Ursachen der Parkinson-Krankheit zu behandeln, und in Zukunft erste Strategien zur Präzisionsmedizin sein können.
Wie Parkinson entsteht
Die Parkinson-Krankheit ist nach der Alzheimer-Krankheit die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung, von der etwa zwei Prozent der Bevölkerung über 60 Jahre betroffen sind. Die motorischen Störungen bei Parkinson entstehen durch das vorzeitige Altern von Nervenzellen im Bereich der Substantia nigra im Mittelhirn. Diese Nervenzellen produzieren eine Substanz namens Dopamin, die als Botenstoff im Gehirn eine wichtige Rolle bei der Ausführung von Bewegungen und bei der Steuerung unseres Verhaltens spielt. Wird Parkinson diagnostiziert, sind bereits viele dieser Nervenzellen abgestorben, dies führt zu den bekannten Symptomen. Wir wissen allerdings, dass nicht nur die Dopamin-produzierenden Nervenzellen betroffen sind, sondern auch andere Signalstoffe im Gehirn bei Parkinson beeinflusst werden und etwa zu Depressionen oder Vergesslichkeit beitragen können.
Quelle: www.parkinson.lu
Was weiß die Forschung heute über die Ursachen von Parkinson?
AG: Wir gehen von einem Zusammenspiel aus Genetik, Umweltfaktoren und Alter aus. Etwa zehn Prozent der Fälle beruhen auf einer einzelnen Genmutation. Weitere Risikogene wie etwa Mutationen des Gens GBA1 erhöhen die Anfälligkeit. Diese Veränderungen beeinflussen die Funktion bestimmter Proteine und wirken sich auf bestimmte Nervenzellen im Gehirn aus. In einer unserer jüngsten Publikationen konnten wir auch zeigen, dass eine Kombination mehrerer Genvariationen, die einzeln gesehen die Krankheit nicht auslösen, gemeinsam mit einem erhöhten Parkinson-Risiko einhergehen. Diese Varianten betreffen die Funktionsweise der Mitochondrien – kleine Kraftwerke in unseren Zellen, die Nahrung in Energie umwandeln.
Erwiesen ist, dass auch Umwelteinflüsse wie zum Beispiel Pestizide oder Lösungsmittel Parkinson auslösen können. Bei Parkinson kommt es oft zu Ablagerungen des Eiweißmoleküls alpha-Synuklein in Nervenzellen. Pestizide oder Lösungsmittel lassen alpha-Synuklein verklumpen. Daneben haben auch Schädel-Hirn-Traumata, andere Krankheiten wie Diabetes sowie der Lebensstil einen Einfluss. So kann Sport das Voranschreiten von Veränderungen im Gehirn verlangsamen.
Gibt es noch keine Möglichkeiten zur Früherkennung?
AG: Wenn die typischen Parkinson-Symptome auftreten, sind in der Regel schon etwa die Hälfte aller betroffenen Nervenzellen nicht mehr vorhanden. Es wäre also sinnvoll, die Krankheit schon Jahre vor Ausbruch zu erkennen und auf zukünftige Therapien zu hoffen, die das Voranschreiten schon im Frühstadium verzögern könnten. Das ist ein wichtiger Forschungsansatz. Viele Studien konzentrieren sich derzeit auf Menschen mit hohem Parkinson-Risiko, bei denen die Krankheit noch nicht ausgebrochen ist.
Luxemburgs Forschung ist Partner der 2022 gestarteten Studie „Gesund Altern“ (HeBA), die diese Menschen identifizieren will und sich inzwischen über mehr als 8700 Teilnehmer freut. Die Studie wird parallel von Luxemburg und Forschungszentren in Deutschland, Österreich und Spanien durchgeführt, die Daten werden zentral hier am LCSB betreut. Zu den bereits bekannten Risikogruppen zählen zum Beispiel Personen, die an einer bestimmten Schlafverhaltensstörung leiden. Sie haben eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, binnen zehn Jahren Parkinson zu entwickeln.
Wie wird Parkinson heute behandelt? Sind in Luxemburg alle Therapien verfügbar?
RK: Da Parkinson heute noch nicht geheilt werden kann, konzentriert sich die Behandlung auf die Linderung der Symptome. Medikamente lindern den Dopaminmangel im Gehirn oder verhindern dessen Abbau, dazu kommen Maßnahmen wie Physio- oder Ergotherapie. In fortgeschrittenen Stadien können manche Patienten von Pumpensystemen profitieren, die kontinuierlich Medikamente verabreichen. Für etwa zehn Prozent der Patienten kommen zudem Hirnschrittmacher in Betracht. Patienten in Luxemburg werden nach den neuesten internationalen Standards behandelt. Betroffene haben Zugang zu allen weltweit verfügbaren Therapieoptionen und können alle auf dem Markt erhältlichen Medikamente verschrieben bekommen.
Vor allem aber haben Luxemburgs Patienten seit 2018 das ParkinsonNet – ein Versorgungsnetzwerk nach niederländischem Vorbild. Dabei leitet ein multidisziplinäres Team den Patienten durch die Therapie. Niederländische Studien haben gezeigt, dass die Sterblichkeit von Parkinson-Patienten niedriger ist, wenn sie von Teams statt in einem unkoordinierten Gesundheitssystem behandelt werden. In unserem Netzwerk arbeiten Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Orthophonisten, Psychologen, Ernährungsberater, spezialisierte Parkinsonpflegekräfte und Neurologen zusammen. Die Patienten brauchen bis zu 19 verschiedene Berufsgruppen für ihre Behandlung; acht haben wir bereits zusammengebracht und bilden sie in Abendkursen weiter. Wer als Patient noch nicht Mitglied im ParkinsonNet ist, kann sich weiterhin anmelden (siehe Infokasten).
ParkinsonNet Luxembourg – das Netzwerk für Patienten
ParkinsonNet ist ein aus den Niederlanden stammendes Konzept, das für eine integrierte Versorgung von Parkinson-Patienten steht. Es verbessert kontinuierlich den Austausch zwischen Patienten und Fachleuten und bietet eine optimale Behandlung nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Mitglieder erhalten Zugang zu Fachleuten und sind eingeladen, die Forschung zu unterstützen. Darüber hinaus bietet das Netzwerk Fortbildungen für Ärzte und andere Gesundheitsdienstleister an.
Das ParkinsonNet Luxembourg ist für Patienten gratis; Kosten werden von der CNS erstattet. Bereits über 500 Patienten sind Mitglied des Netzwerks. Mehr Informationen für Betroffene, Angehörige und Ärzte unter www.parkinsonnet.lu, Tel. +352 44 11 66 35 oder per E-Mail an info@parkinsonnet.lu.
Wieso benötigen Parkinson-Patienten so viele Disziplinen zur Behandlung?
RK: Parkinson ist chronisch, betrifft meist ältere Menschen, die oft schon andere Leiden haben, und hat viele Gesichter. Die Symptome sind von Patient zu Patient unterschiedlich – manche zittern zum Beispiel gar nicht – die Ursachen auch. Um auf die unterschiedlichen Ausprägungen der Erkrankung einzugehen, braucht jeder Patient eine individuelle Therapie aus Medikamenten und weiteren Maßnahmen. So kann der Orthophonist mit Patienten, die unter Schluckstörungen leiden, das Schlucken trainieren und Lungenentzündungen durch verschlucktes Essen verhindern. Spezialisierte Krankenschwestern klären Angehörige auf, damit Medikamente richtig eingenommen werden. Und der Physiotherapeut hilft Patienten, ihr Risiko für Stürze und Knochenbrüche zu verringern, was wiederum teure Operationen und Rehabilitation spart. Niederländische Studien zeigen bereits, dass die Versorgung durch multidisziplinäre Teams die Kosten von Parkinson für das öffentliche Gesundheitssystem reduziert.
Wie könnte Parkinson besser behandelt werden – welche Forschungsansätze sind vielversprechend?
AG: Die Forschung hat in der Vergangenheit bei der Linderung der Symptome viele Fortschritte gemacht. Nun wird mit neuen Methoden daran geforscht, die molekularen Mechanismen und damit die Entstehung von Parkinson besser zu verstehen und ursächliche Therapien zu entwickeln. Wie bereits erwähnt kommt es bei Parkinson oft zu Ablagerungen des Eiweißmoleküls alpha-Synuklein in Nervenzellen. An diesem und mindestens zehn weiteren Proteinen wird intensiv geforscht. Wir wollen analysieren, wie Proteine Signale weiterleiten und miteinander interagieren, also wie es vom defekten Protein bis zum Absterben von Nervenzellen kommt und wo genau man eingreifen könnte, um die Krankheit aufzuhalten.
Ein weiterer Ansatz ist, die verschiedenen genetischen Profile der Patienten zu analysieren, sie in Untergruppen einzuteilen und die Therapien dann gezielt an die Gruppen anzupassen – das nennen wir Präzisionsmedizin (siehe Infobox „FNR-Award“). Träger einer Mutation des Gens GBA1, die ein deutlich erhöhtes Parkinson-Risiko haben, machen in Luxemburg etwa zwölf Prozent aller Parkinsonpatienten aus. Für diese Gruppe entwickeln Pharmaunternehmen jetzt schon spezielle Medikamente.
Auszeichnung für personalisierte Therapie
Prof. Rejko Krüger und Dr Ibrahim Boussaad haben den Machbarkeitsnachweis (Proof of Concept) für eine personalisierte Therapie vorgelegt, die Betroffenen einer seltenen familiären Form von Parkinson helfen und als Modell für andere, häufigere Parkinsonformen dienen könnte. Diese seltene Untergruppe weist eine Mutation eines bestimmten Gens auf. Die Therapie bestand aus einer Kombination eines bereits zugelassenen Medikaments mit einem weiteren Wirkstoff, die den Defekt in den Zellen der Patienten reparierten und damit an der Ursache der Krankheit ansetzten. Die Forscher konnten zudem zeigen, dass diese Mechanismen auch in anderen Genen eine Rolle spielen und dass diese Veränderungen bei Parkinsonpatienten häufiger vorkommen als bei gesunden Menschen. So könnte diese Therapie auch anderen Parkinsongruppen helfen. Hilfreich dabei war eine roboterbetriebene Plattform für Arzneimittelscreening, die die Forscher in ihrem Labor durch die Förderung im Rahmen des PEARL Programms des FNR entwickelten. Für diese Leistungen erhielten Krüger und Boussaad im Jahr 2022 den „FNR Award 2022 for Outstanding Scientific Achievement“.
Möglich machen das die großen technologischen Fortschritte der vergangenen zwei Jahrzehnte. Wir können heute im Labor verkleinerte Hirnstrukturen mit aus der Haut der Patienten gewonnenen Stammzellen züchten. Wir können an lebenden Nervenzellen arbeiten und in kürzester Zeit Erbinformationen entschlüsseln. Dazu kommen Digitalisierung und künstliche Intelligenz, die riesige Datensätze verarbeiten. KI-basierte Technologien können Proteinstrukturen vorhersagen und liefern quasi über Nacht Ergebnisse, für die wir früher Jahre brauchten. Die Hälfte unserer Forscher am LCSB sind Bioinformatiker. Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit aus Biologen und Computerexperten hat zusammen mit KI meiner Ansicht nach ein enormes Potential. All diese Entwicklungen werden die Forschung deutlich schneller vorantreiben. Außerdem wird die internationale Zusammenarbeit immer intensiver. Forscher arbeiten heute mit gewaltigen Kohorten von Patienten aus vielen Ländern.
Steht die Forschung Ihrer Meinung nach kurz vor einem Durchbruch?
RK: Es wird vermutlich nicht den einen großen Durchbruch geben, sondern kontinuierliche Entdeckungen, die ineinandergreifen. Vor 20 Jahren haben Forscher entdeckt, dass das Eiweißmolekül alpha-Synuklein bei allen Parkinson-Patienten im Gehirn verklumpt. Jetzt hat eine spannende Studie gezeigt, dass Antikörper, die genau dieses Protein attackieren, bei Patienten den Verlauf der Krankheit bremsen können. Weitere klinische Studien sind noch nötig, um die Resultate zu sichern. Doch es wäre großartig, wenn wir so den natürlichen Verlauf der Krankheit bremsen könnten. Das Beispiel illustriert, wie lange Forschung von der Entdeckung bis zur Therapie braucht und wie eine Entdeckung auf der anderen aufbaut.
Vor zehn Jahren haben sich Luxemburgs Forschungsakteure LIH, LCSB, die Biobank (IBBL) und das CHL zum „National Centre of Excellence in Research on Parkinson’s disease“, kurz NCER-PD, zusammengeschlossen. Was hat diese gemeinsame, vom FNR finanzierte Forschung gebracht?
AG: Auf der Forschungsseite haben wir gemeinsam neue Biomarker für die Frühdiagnose entwickelt, wichtige Erkenntnisse über die Mechanismen der Neurodegeneration bei Parkinson gewonnen und eine der umfassendsten Parkinson-Kohorten Europas mit genetischen Profilen und Blutproben von mehr als tausend Patienten und über 300 Risikopersonen aufgebaut. Dank dieser Kohorte, die heute vom LIH federführend betreut wird, und unserer Forschungsresultate genießt das Luxemburger NCER-PD heute weltweit Anerkennung.
Luxemburgs Parkinson-Forschung wird also auch international wahrgenommen?
AG: Dank des NCER-PD ist Luxemburg weltweit in der Parkinson-Forschung sichtbar und ein wichtiger Teil der von der Michael J. Fox Stiftung international geförderten Parkinson’s Progression Markers Initiative (PPMI). Wir nehmen als einer von 51 klinischen Standorten weltweit an dieser wegweisenden klinischen Beobachtungsstudie teil. Dadurch wurde unsere Patientenkohorte international sichtbar. Forscher aus der ganzen Welt kontaktieren uns und fragen Proben von Patienten für ihre Studien an. Die Michael J. Fox Foundation plant nun, alle Parkinson-Fälle einschließlich Patientenproben rund um den Globus zu sammeln. Das könnte gewaltige länderübergreifende Analysen ermöglichen und die Forschung schneller voranbringen. Teil dieser internationalen Bewegung zu sein, ist für Luxemburg ein Riesenerfolg.
Was haben heutige Patienten konkret davon?
RK: Durch begleitende Initiativen wie dem ParkinsonNet Luxembourg können heute alle Parkinson-Patienten in Luxemburg nach dem neuesten Wissensstand behandelt werden. Es war uns wichtig - und auch Voraussetzung für die öffentliche Förderung - dass Patienten hier und jetzt von Forschung und Innovationen im Land profitieren, nicht nur zukünftige Generationen. So entstand die Idee des ParkinsonNet.
Dank unserer Patientenkohorte werden Pharmafirmen auf Luxemburg aufmerksam und bieten hier klinische Studien an, durch die Patienten früher an neuartige Medikamente kommen können. Zum Beispiel für Luxemburgs Parkinson-Patienten mit der GBA1-Genmutation: Ab Herbst können bis zu 15 Betroffene im Rahmen einer klinischen Studie mit dem Pharmaunternehmen Roche eine Antikörperinfusion erhalten. Wir erwarten, dass Menschen mit dieser Genmutation besonders gut darauf ansprechen. In die Apotheke kommt dieses Medikament erst in ein paar Jahren.
Das NCER-PD hat mit seiner Aufklärungsarbeit zudem dazu beigetragen, dass Parkinson heute weniger als Tabu empfunden wird. Wir sind dem FNR sehr dankbar, dass er diese Forschung durch das erste Nationale Exzellenzprogramm gefördert und finanziert hat. Am Ende der Förderperiode hatten wir sogar mehr Drittmittel eingeworben, als an öffentlichen Geldern aus Luxemburg investiert wurde. Öffentliche Forschung lohnt sich – für die Patienten, aber auch für die gesamte Gesellschaft.
Autorin: Britta Schlüter
Redaktion: Michèle Weber (FNR)