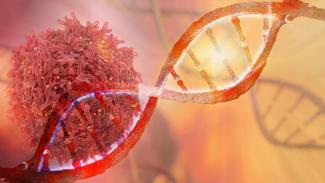
AdobeStock/catalin
Bei Krebs spielen die eigenen Zellen verrückt - verursacht durch Veränderungen in unserem Erbgut. Hier abgebildet sind eine Zelle und ein DNA-Molekül.
In Luxemburg sterben jedes Jahr rund 1100 Menschen an Krebs. Bei Männern ist Krebs die häufigste Todesursache und bei Frauen die zweithäufigste. Tumorerkrankungen zählen damit zu unseren großen Gesundheitsproblemen. Der Kampf gegen Krebs ist ein Schwerpunkt der Gesundheitspolitik (siehe Infokasten "Nationaler Krebsplan") und ein wichtiger Forschungsbereich des Landes.
In der Krebsforschung investiert das Großherzogtum gezielt in Forschungseinrichtungen, fördert internationale Kooperationen und legt einen Schwerpunkt auf innovative Ansätze. Dazu zählt vor allem die personalisierte Medizin, also die Anpassung von Therapien an genetische und andere Besonderheiten der Patienten, und die molekulare Diagnostik, bei der bestimmte Merkmale von Tumorzellen untersucht werden. Mit seiner kleinen Bevölkerung eignet sich Luxemburg in vielen Forschungsbereichen besonders gut als Testlabor.
Welche Vorteile bringt uns Krebsforschung im eigenen Land?
„Es ist absolut wichtig, dass in Luxemburg Krebsforschung betrieben wird“, betont Dr. Guy Berchem, Onkologe und Präsident des Institut national du Cancer (INC). „Erstens muss die Grundlagenforschung in möglichst vielen Forschungszentren stattfinden, damit wir Fortschritte machen und die Mechanismen von Krebs verstehen können. Zweitens müssen wir klinische Forschung betreiben – also Forschung, die auf Patienten angewandt wird und diese in Therapieversuche mit neuen Medikamenten oder neue chirurgische oder strahlentherapeutische Techniken einbezieht. Es wurde deutlich gezeigt, dass Patienten, die in klinische Studien einbezogen werden, besser betreut und behandelt werden und eine höhere Lebenserwartung haben als nicht einbezogene Patienten.“ So habe sich Luxemburg in den letzten 20 Jahren zum Beispiel intensiv mit der Immuntherapie bei Krebs beschäftigt. „Dank dieser Forschung können wir derzeit viele Patienten nicht mit Chemotherapie, sondern mit einer Stimulierung des Immunsystems behandeln, entweder direkt durch monoklonale Antikörper oder indirekt durch Zellen, die in Tumortöter umgewandelt wurden“, erläutert Dr. Berchem.
„Forschung ist der Garant für eine qualitativ hochwertige Medizin“, unterstreicht auch die Direktorin der Fondation Cancer, Margot Heirendt. Auch für die Rekrutierung von Onkologen und anderen Top-Medizinern sowie Luxemburgern, die ihr Medizinstudium im Ausland absolviert haben, sei die Nähe zur medizinischen Forschung ein Attraktionsfaktor. Darüber hinaus fördere Forschung die Entwicklung der Universität und mache das Studium attraktiver.
Wer betreibt Krebsforschung in Luxemburg?
Wichtigste Akteure der Krebsforschung im Land sind das Luxembourg Institute of Health (LIH) und die Universität Luxemburg. Sie betreiben Grundlagen-, angewandte und translationale Forschung im Labor. Letzteres bezeichnet Forschung, die in klinische Anwendungen übertragen wird. Die klinische Forschung selbst geschieht in den onkologischen Zentren der Krankenhäuser des Landes. LIH und Universität arbeiten bei vielen Projekten in Partnerschaft mit den Spitälern. Diese enge Zusammenarbeit zwischen Kliniken und Forschung kommt wiederum den Patienten im Land zugute. Die Krebsforschung wird darüber hinaus unterstützt vom Laboratoire National de Santé (LNS). Auch das Institut National du Cancer, das die Strategie zur Bekämpfung von Krebserkrankungen in Luxemburg koordiniert, fördert Kontakte zwischen klinischen Medizinern und Wissenschaft.
Viele Luxemburger Krebsforschungsprojekte nutzen Gesundheits- und Patientendaten sowie Proben. Als Datenbanken im Land dienen etwa die Darmkrebs-Patientenkohorte der Universität Luxemburg oder die am LIH angesiedelte Integrated BioBank of Luxembourg (IBBL). Dazu kommt das ebenfalls am LIH betriebene, 2013 gegründete Nationale Krebsregister (Registre National du Cancer, RNC), das Informationen über alle neuen in Luxemburg diagnostizierten Krebsfälle sammelt und diese vor allem für klinische und epidemiologische Forschung zur Verfügung stellt. „Der Zugang zu hochwertigen, vertrauenswürdigen und einheitlichen Daten ist eine wesentliche Grundlage für die Digitalisierung der Medizin, für elektronische Patientendossiers und auch für die Forschung“, erläutert Fabrice Mouche, Koordinator des „Plan National Cancer 2020-2026“ im Gesundheitsministerium. „Gute nationale Datenbanken zu haben, erlaubt es uns zudem, auch europäische und internationale Daten zu nutzen.“
Finanziert werden die wissenschaftlichen Projekte vom Luxembourg National Research Fund (FNR), über europäische Forschungsgelder, mit Hilfe von Stiftungen wie der Fondation Cancer und ihrer jährlich organisierten Solidaritätsveranstaltung „Relais pour la Vie“ oder der Fondatioun Kriibskrank Kanner und ihrem "Letz Go Gold"-Lauf, sowie durch Spendenaktionen wie „Télévie“. Die Fondation Cancer allein hat bis heute rund 22 Millionen Euro in Projekte der Krebsforschung investiert. Die Universität Luxemburg hat kürzlich einen eigenen Krebsforschungsfonds eingerichtet, der Spenden für vielversprechende Projekte entgegennimmt.
Welche Krebsarten werden untersucht?
Am Department of Cancer Research des LIH arbeitet über ein Dutzend Forschungsgruppen mit insgesamt rund einhundert Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Im Zentrum ihrer Arbeit stehen die personalisierte und die translationale Medizin. Ziel ist, Behandlungen von Krebspatienten nicht nur auf die Krebsart oder ein Organ, sondern auch auf die genetischen und molekularen Eigenschaften eines Tumors abzustimmen. Dabei erforschen die LIH-Experten bestimmte biologische Eigenschaften von Tumoren oder spezifische Forschungs- und Therapieansätze:
- Immunonkologie - Krebsbekämpfung mit Hilfe des Immunsystems,
- Neuroonkologie - Krebs im Nervensystem, z.B. Tumoren des Gehirns oder des Rückenmarks,
- Tumormikroumgebung –Blutgefäße, Immunzellen, Bindegewebe, Moleküle rund um den Tumor, die diesen beeinflussen,
- Tumorstoffwechsel – der veränderte Stoffwechsel von Tumorzellen,
- Tumorgenetik – die Untersuchung genetischer Veränderungen, die zu Krebs führen.
Besondere Expertise besteht im LIH nach Auskunft des Instituts für Krebsarten wie
- Hirntumore sowie
- bösartige Bluterkrankungen (Leukämien), insbesondere für die chronische lymphatische Leukämie, die häufigste Leukämieform bei Erwachsenen.
Mehr Infos zur Krebsforschung am LIH auf der Internetseite des Instituts.
Das Department of Life Sciences and Medicine (DLSM) der Universität Luxemburg umfasst vier Gruppen, die zu Krebs forschen. Die insgesamt rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind spezialisiert auf
- Tumorbiologie – die Untersuchung der biologischen Grundlagen von Krebs wie etwa Zellverhalten oder genetische Mutationen,
- Arzneimittelscreening – die systematische Suche nach Wirkstoffen gegen Krebszellen mit Hilfe neuer Biomarker,
- Computergestützte Biologie – der Einsatz von Bioinformatik, Künstlicher Intelligenz und Datenanalyse, um biologische Daten besser zu verstehen.
Die Forscher nutzen außerdem In-vitro-Modelle, bei denen menschliche oder tierische Krebszellen im Reagenzglas oder Petrischalen kultiviert und untersucht werden. Bei den Krebsarten konzentriert sich das Department auf
- Darmkrebs, einen der am häufigsten diagnostizierten Krebsarten weltweit,
- Melanome (bösartiger Hautkrebs),
- Leberkrebs,
- Brustkrebs.
Mehr Infos zu dieser Krebsforschung auf der Internetseite der Uni Luxemburg.
Auch die Universität unternimmt erhebliche Anstrengungen, um personalisierte Krebstherapien voranzubringen. Darüber hinaus arbeitet die Universität mit Hilfe der Krankenhäuser, des LIH, des LNS und der Biobank an der Einrichtung einer nationalen Darmkrebs-Patientenkohorte und hat bis heute rund 4.000 Gewebeproben von Patienten gesammelt. Diese Proben können von Forschern in Luxemburg und im Ausland für Darmkrebsstudien genutzt werden. So können mit Hilfe der Proben im Labor „Mini-Tumore“ erzeugt werden, die den ursprünglichen Tumor rekapitulieren und so wertvolle, personalisierte Erkenntnisse ermöglichen.
Auch am Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB) der Universität laufen diverse Krebsforschungsprojekte – insbesondere zu Blasenkrebs, Lungenkrebs, Leberkrebs und Darmkrebs. So ist eine Forschergruppe an dem EU-kofinanzierten Projekt ReDiRECt beteiligt, bei dem bereits zugelassene Medikamente, die für andere Krankheiten entwickelt wurden, gezielt gegen Blasenkrebs eingesetzt werden. Andere Projekte untersuchen Zusammenhänge zwischen dem Darmmikrobiom - also der Gesamtheit aller Mikroorganismen im Darm - und Darmkrebserkrankungen, oder das Speichelmikrobiom von Kopf-Hals-Krebspatienten.
Was sind Beispiele wichtiger Entdeckungen?
Luxemburger Forscher helfen zu entschlüsseln, wie sich Immunzellen im Körper orientieren
In einer großen internationalen Zusammenarbeit, die im April 2025 in der Fachzeitschrift Cell veröffentlicht wurde, haben Wissenschaftler gezeigt, wie Zellen komplexe chemische „Navigationssignale“ interpretieren, um sich im Körper zu bewegen - ein Schritt hin zu intelligenten Therapien, die Immunzellen gezielt zu Tumoren oder Infektionsherden führen können. Im Zentrum der Entdeckung standen die Chemokine - kleine Signalproteine - und ihre Rezeptoren, die gemeinsam steuern, wie und wohin sich Zellen bewegen. Die Studie wurde von Forscherteams des St. Jude Children’s Research Hospital und des Medical College of Wisconsin geleitet, mit wesentlichen Beiträgen des LIH. Mehr Infos hier.
Fibroblasten-Art treibt das Wachstum von Darmkrebs voran
Forscher der Universität Luxemburg haben in Zusammenarbeit mit Krankenhäusern, Biobank und LNS eine laufende Sammlung von Proben von über 200 Darmkrebspatienten angelegt. Anhand der Proben fand das Team eine neue, mit Krebs assoziierte Art von Fibroblasten - bestimmten Zellen des Bindegewebes - die das Tumorwachstum vorantreibt. Wenn man weiß, welche Fibroblasten das Tumorwachstum fördern, kann man gezielt Medikamente entwickeln, die diese blockieren. Die Forscher deckten auch die Rolle des „Wirts-Mikroben-Crosstalks“ - der Kommunikation zwischen den Mikroben im Darm und dem Körper - bei der krankmachenden Wirkung von Darmkrebs auf. Die Studie zu Fibroblasten und Tumorprogression wurde 2023, die Studie zu Mikroben-Krebs-Kommunikation (Wirts-Mikroben-Crosstalk) 2022 in Nature veröffentlicht.
Immuntherapie: Neue Kombination lässt Tumore nachweislich schrumpfen
Forscher des LIH haben einen neuen Ansatz zur Tumorverkleinerung entdeckt. Ihre Ergebnisse, die 2024 im Molecular Oncology Journal veröffentlicht wurden, beschreiben eine wirksame Immuntherapiekombination. Dabei wird eine bestimmte Klasse von Arzneimitteln, die das Immunsystem stärken, mit einem Wirkstoff kombiniert, der auf die Autophagie abzielt - ein Mechanismus, der bei der Umgehung des Krebsimmunsystems eine Rolle spielt. Dieser duale therapeutische Ansatz führte in präklinischen Studien zu einer deutlichen Verringerung der Tumorgröße und besseren Überlebensraten. Mehr Infos hier.
Neue Erkenntnisse zur Medikamentenresistenz bei Hautkrebs
Forscher der Universität Luxemburg untersuchten eine besonders aggressive Form von Hautkrebs: das NRAS-mutierte Melanom. Ein Problem bei dieser Krebsart ist, dass sie anfangs oft auf eine Behandlung anspricht, aber dann widerstandsfähig wird. Die Wissenschaftler untersuchten die molekularen Prozesse dahinter und fanden ein Molekül, dass ein Frühwarnzeichen für Medikamentenresistenz sein könnte. Sie empfehlen eine bestimmte Kombinationstherapie, um die Wirksamkeit der Behandlung zu verlängern. Zudem entwickelten sie 3D-Modelle von Haut- und Leberkrebs, die echten Tumoren ähneln und es ermöglichen, neue Medikamente besser und eher zu testen. Dies wurde 2023 in der Fachzeitschrift Cell Reports und in STAR Protocols veröffentlicht.
Melanome: neuer vielversprechender therapeutischer Ansatz bei Melanomen
Um Krebs wirksam bekämpfen zu können, muss man besser verstehen, wie sich bösartige Zellen gegen unser Immunsystem schützen. Ein internationales Forscherteam, dem auch Prof. Michel Mittelbronn (damals LIH) angehörte, hat bei bestimmten Tumoren einen wichtigen Abwehrmechanismus aufgedeckt. In ihrer im Jahr 2023 in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlichten Arbeit konnten die Forscher zeigen, wie Krebszellen den Zugang zu unserem Immunsystem blockieren. Diese Erkenntnisse könnten zur Verbesserung der Immuntherapie genutzt werden. Nun müssen klinische Studien folgen. Mehr Infos hier.
Biomarker für die Früherkennung von Darmkrebs
Forscher der Universität Luxemburg beteiligten sich an einer klinischen Studie über die Auswirkungen von Ernährungsänderungen bei Darmkrebs-Patienten, die sich einer sogenannten Checkpoint-Inhibitor-Therapie unterziehen (bestimmte Medikamente in der Immuntherapie). Das Team fand auch mehrere Biomarker für die Früherkennung von Darmkrebs und erhielt eine Proof-of-Concept-Finanzierung durch den FNR, um einen Biomarker für den klinischen Einsatz zu testen. Diese Arbeit führte zu einer Patentanmeldung für neuartige Krebsbiomarker, die nun in weiteren Patientenkohorten überprüft werden. Zur Publikation geht es hier.
Medikament verlangsamt das Fortschreiten von Leukämie
Forscher des LIH wiesen die starke Wirkung eines Medikaments nach, welches das Fortschreiten von Leukämie verlangsamt, indem es die Aktivierung krebsverursachender Gene blockiert. Die Ergebnisse, die 2023 in der Fachzeitschrift Blood veröffentlicht wurden, geben Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie neue Hoffnung und ebnen den Weg für neue therapeutische Ansätze. Mehr Infos hier.
Vielversprechende Medikamente gegen Darmkrebs
Forscher der Universität Luxemburg haben ein spezielles Analyseverfahren namens rFASTCORMICS entwickelt. Damit konnten sie aus echten Patientendaten über 10.000 detaillierte Stoffwechselmodelle von Tumoren erstellen. Mit dieser Methode entdeckten sie drei bereits zugelassene Medikamente, die ursprünglich nicht gegen Krebs entwickelt wurden, aber vielversprechend bei Darmkrebs wirken könnten. Da diese Medikamente bereits auf dem Markt sind, könnten sie schneller eingesetzt werden. Dies eröffnet Patienten auch mehr Chancen auf personalisierte Therapien. Zur Publikation geht es hier.
Nationaler Krebsplan 2020-2026: Der Patient im Mittelpunkt
Luxemburgs zweiter nationaler Krebsplan („Plan National Cancer“) legt den Schwerpunkt auf bessere Daten, spezialisierte Kompetenznetzwerke sowie patientenzentrierte Versorgung. Das Nationale Krebsregister ist dabei ein zentrales Instrument. Zum Plan gehört auch die Forschungsförderung.
Bereits realisiert wurden Forschungsprojekte wie “Colive Cancer“, das die persönlichen Erfahrungen von Krebspatienten sammelt, um so die Versorgung zu evaluieren und langfristig zu verbessern.
Auch ist ein Informationsaustauschsystem für Krebspatienten in Bearbeitung, das dem medizinischen Personal im Notfall den Zugang zu lebenswichtigen Patientendaten erleichtert. Andere, praktische Maßnahmen zielen auf den besseren Zugang zu neuesten Medikamenten, die Nutzung künstlicher Intelligenz in der Radiologie und die Lancierung einer Informationsplattform für unterstützende Behandlung, etwa zur Ernährung bei Krebs. 2026 soll ein mit Patienten und Gesundheitsexperten gemeinsam entwickeltes Pilotprojekt starten, das die Kommunikation der Krebsdiagnose - ein traumatischer Moment für betroffene Menschen - verbessern soll.
Autorin: Britta Schlüter
Redaktion: Michèle Weber (FNR)
Infobox
Statistiques des causes de décès: https://santesecu.public.lu/fr/espace-professionnel/informations-donnees/statistiques-causes-deces.html









