„Ziel mir keng!“ wird sonntagabends nach dem „Wëssensmagazin Pisa“ auf RTL Tëlee ausgestrahlt. Du kannst Dir die Folgen aber auch auf RTL Play und auf dem YouTube-Kanal science.lu ansehen: https://www.youtube.com/user/scienceluxembourg.
Anm. der Redaktion: Dieser Artikel wurde am 25.05.2025 aktualisiert. Die Hypothese der Filterblasen wurde relativiert, und die relevante zusätzliche Quelle hinzugefügt.
Manchmal scrollt man stundenlang durch TikTok, Instagram oder andere Social Media und fragt sich danach: Hat mir das jetzt etwas gebracht? Oder bin ich sogar dümmer geworden?
Selbst in den sozialen Medien wird der Begriff „Brain Rot“ immer populärer, 2024 wurde er sogar von Oxford University Press zum Wort des Jahres ernannt.
„Brain rot“, also wortwörtlich „Hirnfäule“, bedeutet in diesem Zusammenhang, dass wir durch den übermäßigen Konsum von belanglosen oder sinnlosen Online-Inhalten, die uns nicht herausfordern, geistig oder intellektuell abbauen oder zumindest schwächer werden.
Was aber sagt die Wissenschaft dazu, machen Social Media uns wirklich dumm? Oder vielleicht genau das Gegenteil: schlauer?
Dummheit ist nicht direkt messbar. Intelligenz oder kognitive Fähigkeiten wie z. B. Aufmerksamkeit aber durchaus. Das Gleiche gilt für Veränderungen der Gehirnstruktur oder -aktivität.
In diesem Ziel mir keng! haben wir uns angeschaut:
- Welche Auswirkungen von Social Media auf kognitive Fähigkeiten Wissenschaftler bereits messen konnten.
- Wieso es uns – und insbesondere Jugendlichen – so schwerfällt, mit dem Swipen, Scrollen und Klicken aufzuhören, selbst wenn wir merken, dass dieses Verhalten uns nicht wirklich guttut.
Wir haben uns vor allem Studien über Jugendliche angesehen, da sie Social Media oft intensiv nutzen und anfälliger für eine exzessive oder problematische Nutzung sind. In Luxemburg waren das laut der HBSC-Studie 9,1 % der 11- bis 18-Jährigen im Jahr 2022. Vier Jahre zuvor waren es gerade mal 5,9 %.
Social-Media-Nutzung bei Jugendlichen
Fragt man Eltern von 12- bis 16-Jährigen in Luxemburg, wie viel Zeit ihre Kinder ihrer Meinung nach täglich auf Social Media verbringen, dann ist das für ein Drittel weniger als 1 Stunde, während ein weiteres Drittel zwischen 1 und 3 Stunden angibt. Den Eltern nach verbringen ungefähr 20 % der Jugendlichen überhaupt keine Zeit auf sozialen Medienplattformen.
Fragt man dagegen die Jugendlichen selbst, sehen die Ergebnisse anders aus: Nur 6 % bestätigen, dass sie Social Media nicht benutzen, 35 % verbringen dort 1 bis 3 Stunden pro Tag und ein Viertel (24 %) zwischen 4 und 6 Stunden pro Tag. 18 % sind sogar mehr als 6 Stunden täglich auf Social Media. (Quelle: BEE SECURE Radar 2025)
Bei diesem „Ziel mir keng!“ haben uns Dr. Claire van Duin vom CePAS, Dr. Anette Schumacher von der Universität Luxemburg und Prof. Helmut Willems von der Junior Uni Daun bzw. Universität Luxemburg geholfen.



Negative Auswirkungen auf kognitive Fähigkeiten
Zunächst einmal muss man sagen, dass die Studienlage sehr heterogen ist.
Die Studien deuten dennoch darauf hin, dass eine intensive oder problematische Nutzung der sozialen Medien negative Auswirkungen auf kognitive Fähigkeiten, also auf unsere geistige Leistungsfähigkeit, haben könnte.
Intensive oder problematische Nutzung, was heißt das? Forscher definieren dies unterschiedlich. Intensiv bedeutet z. B., dass man viel Zeit auf den sozialen Medien verbringt oder sie immer wieder aufruft, und Schwierigkeiten hat, diesen Konsum zu reduzieren. Problematisch wird es, wenn dieses Verhalten negative Auswirkungen auf den Alltag, das Wohlbefinden oder die psychische Gesundheit hat.
Was Wissenschaftler konkret gefunden haben:
- Intensive Social-Media-Nutzer zeigen im Hirnscan veränderte Verbindungen im Gehirn, insbesondere in Bereichen, die wichtig für Fokus und Konzentration sind (Marciano, Camerini and Morese, 2021; Hu et al. 2022a; Hu et al. 2022b).
- Bei Menschen mit einer problematischen Bildschirmnutzung ist die Aufmerksamkeit reduziert.
- Bei Jugendlichen, die häufig das Internet – also nicht nur Social Media – benutzen, wachsen Hirnstrukturen langsamer, die wichtig für Sprache, Aufmerksamkeit und Denken sind. Auch ihre verbale Intelligenz, also die Fähigkeit, Sprache zu verstehen und zu nutzen, verringert sich.
Aufgepasst: Es handelt sich hierbei lediglich um Korrelationen zwischen intensiver oder problematischer Social-Media-Nutzung und schwächeren kognitiven Fähigkeiten. Sie beweisen aber keine Kausalität, also dass Social Media oder Screentime auch tatsächlich die Ursache für diese Probleme sind. Konzentrationsprobleme könnten ein Grund dafür sein, dass manche Menschen zu intensiveren Social-Media-Nutzern werden. Um Kausalitäten zu beweisen, muss man die gleichen Teilnehmer unter kontrollierten Bedingungen immer wieder über einen längeren Zeitraum untersuchen.
Ob Social Media auch das kritische Denken beeinflussen – positiv oder negativ –, wird von den Forschern derzeit noch untersucht (Cheng et al., 2024; Galindo-Domínguez, Bezanilla & Campo, 2024). Die Algorithmen der sozialen Medienplattformen sind darauf ausgelegt, uns hauptsächlich Inhalte anzuzeigen, die unseren Interessen entsprechen. Dies führt uns potenziell in eine Filterblase hinein, in der wir nur noch Inhalt sehen, der unsere Überzeugungen bestätigt. Da könnte es sein, dass wir aufhören, uns Fragen zu stellen. In der wissenschaftlichen Literatur gibt es aber keine eindeutigen Beweise für diese Filterblasen-Hypothese. Soziale Medien könnten aber auch genutzt werden, um das kritische Denken zu fördern.
Positive Auswirkungen auf kognitive Fähigkeiten
Womit wir bei den guten Nachrichten wären! Durch Social Media könnte man auch Sachen dazulernen oder kognitive Fähigkeiten fördern:
- So kann zum Beispiel TikTok helfen, Englisch als Fremdsprache zu lernen.
- Und verschiedene Jugendliche berichten auch, dass Social Media ihnen helfen, soziale Kompetenzen zu entwickeln und Feedback zu bekommen.
Fazit: Ob Social Media uns dümmer machen, kann die Wissenschaft derzeit nicht abschließend bewerten. Es gibt aber Hinweise dafür, dass eine intensive oder problematische Nutzung dem Gehirn schaden könnte. Soziale Medien können aber auch verschiedene positive Auswirkungen haben.

Diese Folge von Ziel mir keng! wurde von Lucie Zeches (links) und Michèle Weber (rechts) vorgetragen.
Es gibt aber auch gut dokumentierte Zusammenhänge zwischen einer problematischen Social-Media-Nutzung und u. a. Depressionen, Angstzuständen, Schlafdefiziten oder gestörtem Selbstwertgefühl. Es gibt demnach noch andere Gründe als potenzielles „Brainrot“, um seine Social-Media-Nutzung im Auge zu behalten.
Wieso fällt es uns denn so schwer, uns von sozialen Medien zu lösen, selbst wenn wir merken, dass dieses Verhalten uns nicht wirklich guttut?
Wieso wir häufig mehr Zeit auf Social Media verbringen als uns lieb ist
Die meisten Social-Media-Plattformen setzen ganz bewusst ein paar Tricks ein, um uns so lange wie möglich auf der Plattform festzuhalten – damit sie uns mehr Werbung zeigen und entsprechend mehr Geld verdienen können.
- Sie bieten endlosen Inhalt: Unser Gehirn mag Aufgaben, die abgeschlossen sind. Da Social Media aber nie „vorbei“ sind, sondern immer noch ein Video oder eine neue Information für uns parat haben, bleiben wir oft länger als geplant hängen. Außerdem ist der Inhalt hoch personalisiert, auch das trägt dazu bei.
- Unser Belohnungssystem wird immer wieder getriggert. Wenn wir Social Media nutzen, werden im Gehirn verschiedene Regionen des Belohnungssystems aktiviert (Montag et al. 2019, Montag et al. 2023).
Was da genau passiert, wissen die Forscher noch nicht, es gibt aber die Hypothese des Dopamin-Kicks, die wir bereits etwas genauer in diesem Video über die Screentime bei Kindern beleuchtet.
Mit jedem Like, jeder neuen Story oder neuen Information wird unser Belohnungssystem aktiviert. Das fühlt sich gut an – also wollen wir mehr davon. Und schwupp wirds auf einmal zu einer Gewohnheit, die wir schlecht wieder abstellen können.
3. Die Belohnung ist jedoch variabel. Nicht jeder Post oder jedes Video ist spannend. Manchmal jedoch finden wir das perfekte Meme.
Und genau deshalb bleiben wir dran – wie bei einem Glücksspielautomaten.
Forscher wissen, dass das Gehirn von Jugendlichen stärker auf diese Belohnungsmechanismen anspringt.
Die Entwicklung ihres Gehirns ist noch nicht abgeschlossen, besonders im Bereich des präfrontalen Cortex, der kritisches Denken und die Entscheidungsfindung steuert.
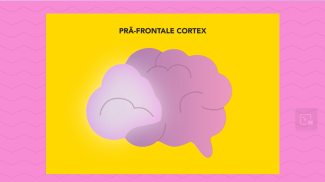
Abbildung: der präfrontale Cortext ist hier hellrosa markiert.
Auch die Angst, etwas zu verpassen (Fear of Missing Out, FOMO) hält uns online.
Fazit
Bei diesem Thema war die Recherche für uns wirklich schwierig! Die wissenschaftliche Literatur ist sehr heterogen, oftmals wird nicht exklusiv die sozialen Medien, sondern die Internet-, digitale Medien- oder Smartphone-Nutzung untersucht. Studien, die zeigen, dass Social Media allein die Ursache für geschwächte kognitive Fähigkeiten sind, gibt es kaum. Und die Forscher wissen allgemein noch relativ wenig darüber, was genau in unserem Gehirn passiert, wenn wir Social Media nutzen.
Unser Fazit: Es kommt wahrscheinlich darauf an, WIE du Social Media nutzt und WELCHE Person du bist! Dies untersuchen Forscher auch jetzt mehr im Detail, um z. B. herauszufinden, wieso verschiedene Menschen gut damit zurechtkommen, andere, die sich gleich verhalten, jedoch nicht. Und auch, ob es einen Unterschied macht, ob man Social Media aktiv oder passiv nutzt, also selber postet und kommuniziert oder nur scrollt.
Und denk dran: Unser Belohnungssystem hat sich bei uns entwickelt, um herausragende Leistungen zu belohnen, z. B. ein Mammut zu erlegen. Heute aber wird es getriggert, wenn wir eine Katze mit Sonnenbrille sehen.
Darauf hat uns die Evolution nicht vorbereitet!
In diesem Sinne: Mach jetzt mal 'ne Pause und lass dies hier erst mal sacken.
Autorin: Michèle Weber (FNR)
Co-Autorin: Lucie Zeches (FNR)
Lektorat: Jean-Paul Bertemes, Linda Wampach, Melanie Reuter (FNR)
Beratung: Claire van Duin (CePAS), Dr. Anette Schumacher (Universität Luxemburg), Prof. Helmut Willems (Junior Uni Daun)
Bei der Hintergrundrecherche half ebenfalls Daniel Saraga (Saraga Communications)
Übersetzung: Nadia Taouil (www.t9n.lu)
Video: SKIN & FNR
Infobox
https://corp.oup.com/news/brain-rot-named-oxford-word-of-the-year-2024/
Catunda, C., Mendes, F.C., & Lopes Ferreira, J. (2024). Comportements à risque des enfants et adolescents en âge scolaire au Luxembourg – Rapport de l’enquête HBSC 2022 menée au Luxembourg. Esch-sur-Alzette. https://hbsc.uni.lu/
https://www.bee-secure.lu/wp-content/uploads/2025/02/166_bee-secure-radar-2025.pdf
Marciano L, Camerini A-L and Morese R (2021) The Developing Brain in the Digital Era: A Scoping Review of Structural and Functional Correlates of Screen Time in Adolescence. Front. Psychol. 12:671817. doi: 10.3389/fpsyg.2021.671817
Hu, B.; Cui, Y.-L.; Yu, Y.; Li, Y.-T.; Yan, L.-F.; Sun, J.-T.; Sun, Q.; Zhang, J.; Wang, W.; Cui, G.-B. Combining Dynamic Network Analysis and Cerebral Carryover Effect to Evaluate the Impacts of Reading Social Media Posts and Science Fiction in the Natural State on the Human Brain. Front. Neurosci. 2022, 16, 66. https://doi.org/10.3389/fnins.2022.827396
Hu, B.; Yu, Y.; Yan, L.F.; Qi, G.Q.; Wu, D.; Li, Y.T.; Shi, A.P.; Liu, C.X.; Shang, Y.X.; Li, Z.Y. Intersubject correlation analysis reveals the plasticity of cerebral functional connectivity in the long-term use of social media. Hum. Brain Mapp. 2022, 43, 2262–2275. https://doi.org/10.1002/hbm.25786
Takeuchi, H., Taki, Y., Asano, K., Asano, M., Sassa, Y., Yokota, S., et al. (2018). Impact of frequency of internet use on development of brain structures and verbal intelligence: Longitudinal analyses. Hum. Brain Mapp. 39, 4471–4479. https://doi.org/10.1002/hbm.24286
Cheng, L., Fang, G., Zhang, X., Lv, Y. and Liu, L. (2024), "Impact of social media use on critical thinking ability of university students", Library Hi Tech, Vol. 42 No. 2, pp. 642-669. https://doi.org/10.1108/LHT-11-2021-039
Galindo-Domínguez, H., Bezanilla, M.J. & Campo, L. Relationship between social media use and critical thinking in university students. Educ Inf Technol (2024). https://doi.org/10.1007/s10639-024-12953-z
M. Cinelli, G. De Francisci Morales, A. Galeazzi, W. Quattrociocchi, & M. Starnini, The echo chamber effect on social media, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 118 (9) e2023301118, https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118 (2021).
Ross Arguedas, A., Robertson, C., Fletcher, R., & Nielsen, R. (2022). Echo chambers, filter bubbles, and polarisation: a literature review . Reuters Institute for the Study of Journalism. https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:6e357e97-7b16-450a-a827-a92c93729a08
Adnan, N. I., Ramli, S., & Ismail, I. N. (2021). Investigating the usefulness of TikTok as an educational tool. International Journal of Practices in Teaching and Learning (IJPTL), 1(2), 1-5. https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/52140/1/52140.pdf
West, M., Rice, S., & Vella-Brodrick, D. (2023). Adolescent social media use: cultivating and constraining competence. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being, 18(1). https://doi.org/10.1080/17482631.2023.2277623
Montag, C., Lachmann, B., Herrlich, M., & Zweig, K. (2019). Addictive features of social media/messenger platforms and freemium games against the background of psychological and economic theories. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(14), Article 14. https://doi.org/10.3390/ijerph16142612
Christian Montag, Laura Marciano, Peter J. Schulz, Benjamin Becker, Unlocking the brain secrets of social media through neuroscience, Trends in Cognitive Sciences, Volume 27, Issue 12, 2023, Pages 1102-1104, ISSN 1364-6613, https://doi.org/10.1016/j.tics.2023.09.005
Marciano L, Camerini A-L and Morese R (2021) The Developing Brain in the Digital Era: A Scoping Review of Structural and Functional Correlates of Screen Time in Adolescence. Front. Psychol. 12:671817. doi: 10.3389/fpsyg.2021.671817
Blakemore, S.-J., & Choudhury, S. (2006). Development of the adolescent brain: Implications for executive function and social cognition. Journal of Child Psychology and Psychiatry, and Allied Disciplines, 47(3–4), 296–312. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2006.01611.x
Auswirkungen sozialer Medien auf mentale Gesundheit. Press Briefing Science Media Center Germany (2023) https://www.sciencemediacenter.de/angebote/23213






