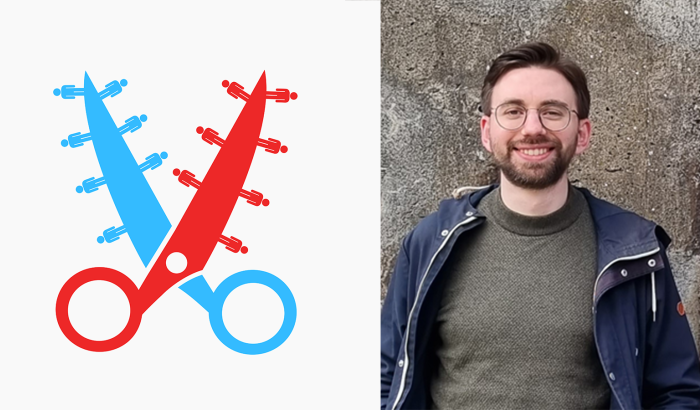Die Forscher Christine Schiltz und Thomas Lenz von der Universität Luxemburg haben ihren Bericht auf der Konferenz „Research meets Politics“ vorgestellt und mit Abgeordneten diskutiert.
Luxemburg ist eines der Mitgliedsländer der EU mit dem größten Anteil an Menschen mit Hochschulabschluss. Es ist aber gleichzeitig auch eines der europäischen Länder mit der größten Bildungsungleichheit: Der sozioökonomische und kulturelle Status der Eltern sowie die Familiensprache haben einen starken Einfluss auf die Schulnoten, und damit auf die Chancen, eine Sekundarschule und eine Universität zu besuchen. Diese Ungleichheit betrifft vor allem zahlreiche Kinder mit Migrationshintergrund.
Dies hat sowohl individuell als auch gesellschaftlich Folgen: Ein geringeres schulisches Bildungsniveau verringert die Chancen auf dem Arbeitsmarkt, das Einkommen und die Chancen auf eine gute Gesundheit, während gleichzeitig der Gesellschaft weniger Talente als nötig zur Verfügung stehen.
Das Schulsystem des Großherzogtums zeichnet sich dadurch aus, dass Kinder im Allgemeinen dreisprachig unterrichtet werden: Luxemburgisch ist die Sprache der Vorschule, gefolgt von Deutsch bis zum Alter von elf Jahren, schließlich ein wachsender Anteil Französisch, insbesondere im Mathematikunterricht und im klassischen Sekundarunterricht. Da inzwischen fast 70 % der Kinder zu Hause nicht Luxemburgisch sprechen, hat die Frage nach der Schulsprache an Bedeutung gewonnen.
Die Forscher Christine Schiltz und Thomas Lenz der Universität Luxemburg haben für den Wissenschaftlichen Dienst der Abgeordnetenkammer einen neuen Bericht verfasst, der diese Ungleichheiten untersucht und beleuchtet, ob ein diversifiziertes Angebot an öffentlichen Schulen diese Unterschiede abbauen kann. Das Dokument wurde am 24. März 2025 im Rahmen der vom FNR und der Abgeordnetenkammer in der Abtei Neumünster organisierten Konferenz „Research meets Politics“ vorgestellt. Wir stellen hier die Kernaussagen vor.
Eine dreifache Belastung für Migranten mit einer anderen Muttersprache
Die internationalen PISA-Tests sowie die standardisierten Prüfungen (Épreuves standardisées) auf nationaler Ebene lassen eine deutliche Ungleichheit in mehrfacher Hinsicht erkennen. So lagen im PISA-Test 2015 die Ergebnisse von Kindern aus Haushalten mit dem geringsten und jenen aus Haushalten mit dem höchsten sozioökonomischen und kulturellen Status in den Bereichen Textverständnis, Mathematik und Naturwissenschaften um 80 Punkte auseinander. Dies entspricht zwei Jahren Beschulung. Ein zusätzlicher Unterschied von 10 bis 15 Punkten wurde zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund beobachtet, sowie ein Unterschied von 24 bis 31 Punkten (also ein halbes Jahr Beschulung) zwischen Kindern, die Luxemburgisch oder Deutsch zu Hause sprechen, und jenen, die dies nicht tun. Ein Kind, dessen Eltern eingewandert sind, ein geringes Einkommen haben und keine der drei Sprachen des Großherzogtums sprechen, wird also dreifach benachteiligt.
Das Bildungssystem ist flexibler geworden, um insbesondere der großen Sprachenvielfalt in der Bevölkerung Rechnung zu tragen. Sieben öffentliche internationale Schulen bieten Unterricht schwerpunktmäßig auf Französisch, Englisch oder Deutsch an. Einige arbeiten nach den Lehrplänen der Europäischen Schulen oder des Cambridge International Curriculum. Zudem bietet das aktuell an vier Grundschulen getestete Programm „Zesumme Wuessen“ die Möglichkeit einer Alphabetisierung auf Französisch statt auf Deutsch.
Erste positive Ergebnisse
Diese Bemühungen scheinen vielversprechend zu sein, so der Bericht. Die Ergebnisse an internationalen Schulen sind mindestens ebenso gut wie jene an Schulen mit dem Standardprogramm, in Mathematik sogar besser. Diese Tatsache ist auf den allgemein hohen sozioökonomischen Status der Eltern zurückzuführen, die für ihr Kind eine internationale Schule wählen. Der üblicherweise negative Einfluss des Migrationshintergrunds wird so mehr als ausgeglichen.
Das Programm „Zesumme Wuessen“ wurde erst zu Beginn des neuen Schuljahres im Herbst 2023 eingeführt und kann noch nicht abschließend bewertet werden. Die ersten Hinweise sind jedoch vielversprechend, da sich die Noten verbessert haben und die Motivation der Schüler gestiegen ist.
Angebote im Vorschulalter wie Kindertagesstätten oder Mini-Crèches haben eine positive Wirkung, allerdings ist ihr Einfluss im Vergleich zum familiären Einfluss begrenzt. Diese Angebote sollten noch genauer untersucht werden. Der Bericht macht deutlich, dass die Kinder, die weder Luxemburgisch noch Deutsch zu Hause sprechen, Deutsch im Zyklus 2 schlechter verstehen. Dies deutet darauf hin, dass das Erlernen des Luxemburgischen in der Vorschule nicht ausreicht, um den Deutsch-Erwerb vorzubereiten.
Die Sprache beeinflusst die Ergebnisse in Mathe
Der Bericht widerspricht der Idee, dass Mathematik unabhängig von der gesprochenen Sprache erlernt wird. Er unterstreicht, dass sich verschiedene Benachteiligungen summieren - geringes Deutsch-Niveau, Wechsel der Unterrichtssprache während der Schullaufbahn - und zu deutlichen Unterschieden führen. Dies wird beispielsweise bei Kindern deutlich, die zu Hause nur Portugiesisch sprechen (die portugiesische Gemeinschaft ist die größte Gruppe ausländischer Herkunft, nämlich 13,5 % der Bevölkerung): Zwischen dem ersten und dem neunten Schuljahr werden die Unterschiede in Mathematik im Vergleich zur Gruppe der Luxemburgisch, Deutsch oder Französisch sprechenden Kinder immer größer. Zwei Drittel der Portugiesisch sprechenden Kinder erreichen dementsprechend nicht den „Kompetenzsockel“, also das erwartete Mindestniveau, gegenüber einem Drittel der Luxemburgisch, Deutsch oder Französisch sprechenden Kinder.
Der Bericht hebt noch eine andere Tatsache hervor: Unser Gehirn führt Rechenoperationen je nach Sprache unterschiedlich aus, selbst in unserer Muttersprache. Als Ursache ist hier die Zahlenbildung in umgekehrter Reihenfolge im Deutschen zu nennen, sowie die hybride Zahlenbildung zwischen 70 und 99 im Französischen. Der große Einfluss der Sprache auf die Mathematik-Ergebnisse sollte bei der Diagnose von Dyskalkulie stärker berücksichtigt werden. Aktuell wird Dyskalkulie zu häufig bei fremdsprachigen Kindern und zu selten in der Sprachgruppe Luxemburgisch-Deutsch diagnostiziert.
Da die Mathematik-Ergebnisse mit dem späteren beruflichen Erfolg korrelieren, würde die Reduzierung dieser Unterschiede entscheidend zur Bekämpfung der Ungleichheit beitragen. Eine Möglichkeit bestünde darin, einen umfassenderen Erwerb der Unterrichtssprache für Mathematik zu fördern und diese Sprache beizubehalten. Beispielsweise könnten die Kinder, die auf Französisch alphabetisiert wurden, Mathematikunterricht auf Französisch erhalten.
Die Mehrsprachigkeit hat ein positives Image, kann aber zu Schwierigkeiten in Mathematik führen, wenn ein Kind die Sprache wechseln muss. Mehrere Sprachen sprechen hat nicht dieselbe Bedeutung für ein Kind, das mindestens eine der drei in Luxemburg gesprochenen Sprachen von zu Hause kennt, und für ein Kind, das in einem Haushalt mit einer anderen Sprache lebt: Letzteres wird während seiner gesamten Schullaufbahn mit zusätzlichen Schwierigkeiten konfrontiert sein.
Möchtest Du den ganzen Bericht lesen? Hier ist er: Different schools for different pupils? What are the advantages and problems of Luxembourg's highly differentiated and stratified school system?, von Thomas Lenz und Christine Schiltz, Luxemburg, für den Wissenschaftlichen Dienst der Abgeordnetenkammer, 17. März 2025.



Das luxemburgische Schulsystem
Kinder unter vier Jahren können pädagogische Einrichtungen wie Kindertagesstätten oder Mini-Crèches sowie die Vorschule besuchen. In einigen dieser Einrichtungen, insbesondere der Vorschule, werden die Kinder mit anderen Muttersprachen beim Erwerb der luxemburgischen Sprache unterstützt.
Der obligatorische Grundschulunterricht beginnt ab dem Alter von vier Jahren. Umgangssprache ist hier Luxemburgisch. Lesen und Schreiben lernen die Kinder üblicherweise auf Deutsch ab dem Alter von sechs Jahren, wobei das Französische zunächst mündlich eingeführt wird.
Der Sekundarunterricht ab dem Alter von zwölf Jahren findet auf Deutsch statt mit Ausnahme des Mathematik-Unterrichts, der auf Französisch gegeben wird.
Ab dem Alter von 15 Jahren ist Französisch Unterrichtssprache im klassischen Sekundarunterricht, der zur Abschlussprüfung führt. Deutsch bleibt die Hauptsprache im allgemeinen Sekundarunterricht, der ab dem Alter von 15 Jahren die Berufsausbildung anstrebt.
Parallel dazu bieten internationale Schulen Unterricht auf Deutsch, Französisch oder Englisch an.
Autor: Daniel Saraga
Redaktion: Jean-Paul Bertemes (FNR)
Artikel auf Grundlage des von Christine Schiltz und Thomas Lenz erstellen Berichts des Wissenschaftlichen Dienstes
Übersetzung: Nadia Taouil (www.t9n.lu)