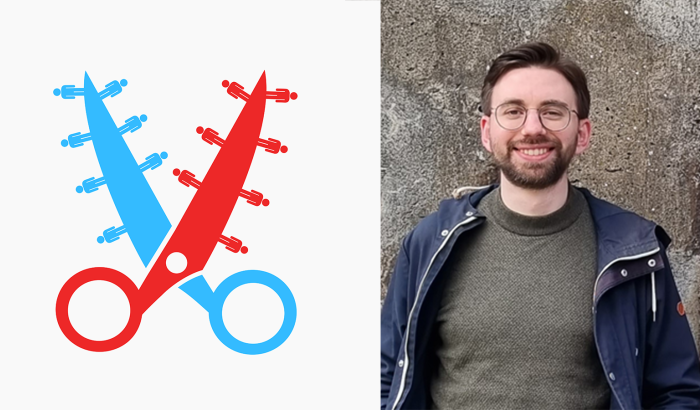Die Wirtschaftswissenschaftlerin Anne-Catherine Guio vom Forschungszentrum LISER hat einen Bericht über Armut für den Wissenschaftlichen Dienst der Abgeordnetenkammer verfasst, der auf der Konferenz „Research meets Politics“ vorgestellt wurde.
Armut gibt es auch in Luxemburg: Ein Fünftel aller Menschen ist hier betroffen. Zur Bekämpfung von sozialer Unsicherheit hat die Regierung eine Fülle an Instrumenten entwickelt, um die Menschen zu unterstützen, die nicht über die Runden kommen.
Leider kommen diese Maßnahmen bei weitem nicht allen zugute, die Anspruch auf sie hätten: 75 % der Haushalte, die einen Mietzuschuss bekommen könnten, beziehen ihn nicht; ebenso 45 % der Menschen, die eine Teuerungszulage erhalten könnten. Eine erste Möglichkeit zur Verringerung sozialer Unsicherheit besteht also darin, sicherzustellen, dass die Menschen tatsächlich von den für sie entwickelten Maßnahmen profitieren.
Ein vom Wissenschaftlichen Dienst der Abgeordnetenkammer beim LISER in Auftrag gegebener Bericht hat die Gründe für diese mangelnde Nutzung der Sozialhilfe untersucht. Er hebt ein Informationsdefizit sowie das Zurückschrecken vor administrativen Prozessen hervor. Ebenso schlägt der Bericht Lösungen für diese Schieflage vor: umfassendere Information der Bevölkerung über verschiedene Kanäle, Vereinfachung und Vereinheitlichung der Verfahren, proaktive Kontaktaufnahme mit den möglicherweise bezugsberechtigten Haushalten.
Am Montag, 24. März wurde der von der Wirtschaftswissenschaftlerin Anne-Catherine Guio vom Forschungszentrum LISER (Luxembourg Institute for Socio-Economic Research) erstellte Bericht der Öffentlichkeit und den Abgeordneten im Rahmen der Konferenz „Research meets Politics“ vorgestellt. Die Konferenz wurde vom Luxembourg National Research Fund (FNR) und der Abgeordnetenkammer in der Abtei Neumünster organisiert. Wir stellen hier die Kernaussagen des Berichts vor.
Etwa fünfzehn bestehende Leistungen
Es existieren zahlreiche Unterstützungsmöglichkeiten - insgesamt etwa fünfzehn -, von der Energieprämie zur Senkung der Heizkosten bis zur Subvention von Schulgebühren. Mehrere Zuschüsse können das Einkommen aufstocken, wie das Einkommen zur sozialen Eingliederung (REVIS), die Teuerungszulage (AVC), die Steuergutschrift für Alleinerziehende (CIM) oder die Beihilfe für einkommensschwache Familien (SMFR). Hinter jeder dieser Bezeichnungen steht eine Maßnahme mit ihren jeweiligen Förderkriterien und Berechnungsregeln. Das führt zu Verwirrung bei den Menschen, die einen entsprechenden Antrag stellen könnten.
Die betroffene Bevölkerungsgruppe kennt diese Instrumente nicht alle. Die Menschen wissen deutlich häufiger von der Teuerungszulage (AVC) als vom Mietzuschuss oder von der Steuergutschrift für Alleinerziehende (CIM). Wie der Bericht unterstreicht, müssen zunächst die Unterstützungsmöglichkeiten besser bekannt gemacht werden. Einerseits über unterschiedliche Informationskanäle - Flyer, Soziale Netzwerke und Presse -, andererseits über Akteure wie Sozialarbeiter, die bereits mit armutsbedrohten Menschen in Kontakt stehen.
Verfahren vereinfachen
Die Verfahren der Antragstellung können die Menschen abschrecken, die sich für eine Unterstützungsleistung interessieren. Dies wird in den von der Wirtschaftswissenschaftlerin geführten Gesprächen deutlich. Die Verpflichtung, jedes Jahr einen neuen Antrag auszufüllen, auch wenn die Angaben häufig identisch zu vorherigen Jahren sind, erntet wenig Verständnis. Ähnliches gilt für die langen Wartezeiten, bis man über den Fortschritt des Antrags informiert wird oder die Subvention erhält, oder die Tatsache, eine Hilfsleistung nicht mehr zu erhalten, eine andere aber weiterhin. Denn die Leistungen werden anhand verschiedener Grenzwerte ausgezahlt, die wiederum unterschiedlich berechnet werden, auf Grundlage des Brutto- oder Nettoeinkommens, auf jährlicher oder monatlicher Basis.
Der Bericht empfiehlt eine Vereinheitlichung der Vergabekriterien und die Vereinfachung der Verwaltungsprozesse. So könnten Formulare beispielsweise automatisch vorausgefüllt werden anhand der Daten, über die die Behörden bereits verfügen. Die Verfahren könnten bei einer zentralen Anlaufstelle gebündelt werden, die auch eine Hotline zur Unterstützung bei der Antragstellung bietet. Dies würde Hemmschwellen abbauen. Denn zahlreiche Anträge - ein Viertel bei der Teuerungszulage und der Energieprämie - werden abgelehnt, weil die Unterlagen unvollständig sind oder nicht fristgerecht eingereicht wurden.
Stigmata abbauen
In den Gesprächen mit der Forscherin bekundeten die befragten Personen ihre Scheu, Sozialhilfe zu beantragen, obwohl sie beispielsweise eine Arbeit haben. Einige Menschen fühlen sich herabgesetzt, wenn sie ihre Lebensmittelausgaben detailliert aufführen müssen, um in Sozialkaufhäuser einkaufen zu dürfen. Diese Geschäfte verkaufen zu geringen Kosten unverkaufte Produkte. Ein vereinfachter oder vertrauensbasierter Zugang könnte die derzeit geltenden administrativen Schritte vereinfachen. Ein weiteres Mittel zur Reduzierung der Stigmatisierung und Selbstzensur wäre die Verwendung neutraler Begriffe. Es könnte von „Scheck“ statt von „Unterstützung“ gesprochen werden, zudem könnten Ausdrücke wie „Armut“ und „geringes Einkommen“ vermieden werden. Die Verwendung „einfacher Sprache“ mit kurzen Sätzen und gängigen Begriffen würde die von komplizierter und schwieriger Verwaltungssprache geschaffenen Hürden abbauen. Diese sprachlichen Barrieren können Menschen entmutigen, die einen Antrag stellen möchten.
Schwelleneffekt vermeiden - Erhöhung des Einkommens nicht bestrafen
Der Bericht schlägt zudem vor, direkt Haushalte anzusprechen, die eine Unterstützungsleistung bekommen könnten. Hier könnte man sich auf die Daten der Vorjahre oder auf Steuerinformationen stützen. Außerdem sollten Ansprechpartner aus der Industrie und dem sozialen Bereich dazu angehalten werden, Unterstützungsmöglichkeiten proaktiv anzusprechen. Ein Energieversorger könnte beispielsweise die Haushalte, die mehrere Rechnungen zu spät beglichen haben, auf die Energieprämie hinweisen, denn verspätete Zahlungen könnten ein Hinweis auf finanzielle Schwierigkeiten sein. Ein einziger Online-Rechner mit Informationen zu allen Hilfen, auf die eine Person Anspruch hat, wäre effizienter als die unterschiedlichen Tools zu den verschiedenen Hilfen, die es heute gibt.
Der Bericht empfiehlt, zur Vermeidung des Schwelleneffekts einen Grenzwert mit Staffelung und Teilzahlungen einzuführen. Der Schwelleneffekt bezeichnet den Verlust einer gesamten Beihilfe, sobald das Einkommen einer Person den Grenzwert knapp überschreitet. Ebenso werden durch die Bedingung, fünf Jahre in Luxemburg wohnen zu müssen, die Menschen ausgeschlossen, die zeitweise nach Frankreich oder Belgien umziehen, weil dort die Mieten günstiger sind, aber weiterhin in Luxemburg arbeiten.
Das Thema Armut wird in der Politik heftig diskutiert. Dieser Bericht zeigt jedoch, dass soziale Unsicherheit bekämpft werden kann, wenn man dafür sorgt, dass alle Menschen die Hilfen bekommen, die sie benötigen und auf die sie ein Recht haben. Dies kann im Wesentlichen durch Änderungen auf Verwaltungsebene erreicht werden.
Möchtest Du den ganzen Bericht lesen? Hier ist er: Comment améliorer le recours aux aides sociales au Luxembourg ?, von Anne-Catherine Guio (LISER) für den Wissenschaftlichen Dienst der Abgeordnetenkammer, 18. März 2025.



Soziale Leistungen in Luxemburg
Autor: Daniel Saraga
Redaktion: Jean-Paul Bertemes (FNR)
Artikel auf Grundlage des Berichts des Wissenschaftlichen Dienstes, von Anne-Catherine Guio vom Forschungszentrum LISER
Übersetzung: Nadia Taouil (www.t9n.lu)