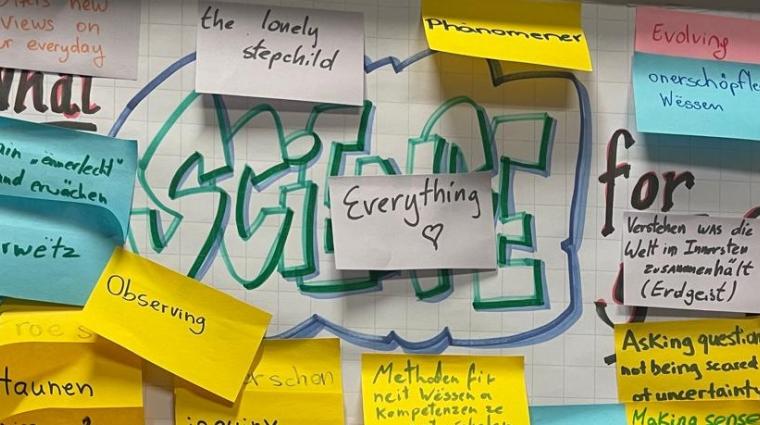© FNR/Yann Wirthor
Benötigtes Material
Zyklus: 4
Dauer: etwa 1 Schulstunde
Letzte Aktualisierung: 08.03.2024
Ablauf
Um dich mit dem Ablauf und dem Material vertraut zu machen, ist es wichtig, dass du das Experiment im Vorfeld einmal durchführst.
Möchtest du die Kinder das Experiment dokumentieren lassen? Am Ende dieses Artikels (über der Infobox) findest du ein Forschungsblatt (PDF mit zwei A4-Seiten), welches die Kinder hierfür nutzen können.
Schritt 1: Stellt eine Frage und formuliert Hypothesen
Die Frage, die ihr euch in dieser Einheit stellt, lautet:
Wie viel Luft passt in unsere Lungen?
Möglicher Einstieg: Bitte die Schülerinnen und Schüler, ihre Augen zu schließen und die Hände auf den Hals, dann auf den Brustkorb (und vielleicht auch den Bauch und die Taille) zu legen und ein paarmal tief ein- und auszuatmen. So können sie selbst den Weg der Atemluft verfolgen. Sie können spüren, wie die Luft ein- und ausströmt und wie der Brustkorb sich ausdehnt und wieder abflacht.
Lasse die Kinder Hypothesen aufstellen, wie viel Luft (in Litern) wohl in ihre Lungen passt. Damit sich die Kinder gut vorstellen können, wie viel Volumen einem Liter entspricht, zeige ihnen den Messbecher oder weise sie darauf hin, dass Saft und Milch häufig in 1-Liter-Packungen angeboten werden.
Weiter Fragen, die du aufwerfen kannst: Haben alle Menschen gleich große Lungen? Wovon hängt die Lungengröße ab? Gibt es Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen? Ist das Lungenvolumen abhängig von der Körpergröße, vom Gesundheitszustand etc.? Ist das Lungenvolumen von sportlichen Menschen größer als das von eher unsportlichen Menschen?
Zeichnet und notiert eure Hypothesen und/oder haltet sie an der Tafel fest. Teilt sie mit der Klasse und begründet eure Überlegungen. Die richtige Antwort zu finden ist hier nebensächlich. Es geht vielmehr darum Ideen zu entwickeln und herauszufinden, was die Kinder bereits wissen.
Frage die Kinder anschließend, ob sie eine Idee haben, wie sie ihr Lungenvolumen mit einem Experiment messen könnten. Um sie zu dem vorgeschlagenen Experiment hinzuführen, kannst du ihnen auch das Material für das Experiment zeigen.
Schritt 2: Führt das Experiment durch
Um ihr Lungenvolumen in Litern zu bestimmen, messen die Kinder, wie viele Liter Wasser aus einem randvoll gefüllten Eimer herauslaufen, wenn man einen Luftballon hineindrückt, der mit der Luft einer Ausatmung gefüllt ist.
Gehe folgende Schritte gemeinsam mit den Kindern durch, aber lasse sie das Experiment selbst durchführen:
- Stellt den Eimer in den Behälter oder die Wanne und füllt ihn randvoll mit Wasser.
- Nehmt tief Luft und atmet einmal in den Luftballon aus. Versucht, so viel Luft wie nur möglich mit einer Ausatmung in den Ballon zu blasen. (Da sich einige Ballons beim erstmaligen Gebrauch nur schwer aufblasen lassen, könnt ihr euren Ballon auch im Vorfeld einmal aufblasen und die Luft wieder entweichen lassen.)
- Verknotet den Ballon.
- Drückt euren Ballon nun in den mit Wasser gefüllten Eimer. Versucht, ihn vollständig im Eimer zu versenken.
- Nun könnt ihr das übergelaufene Wasser, das sich in der Schüssel oder in der Wanne angesammelt hat, in den Messbecher schütten und das Volumen ablesen.
Schritt 3: Beobachtet was passiert
Je nach Alter, Fitness und Körpergröße werden die Kinder zwischen 1,5 und 3,0 Litern messen. Die Angaben beziehen sich auf Kinder, die 10 – 11 Jahre alt und 140 – 145 cm groß sind (Quelle: www.leichter-atmen.de/lungenfunktionstest-werte).
Da es unmöglich ist, die Lungen vollkommen zu entleeren, ist das tatsächliche Lungenvolumen etwa einen Liter größer als gemessen.
Entsprechen die Resultate in etwa den Schätzungen der Kinder? Lasse die Kinder berichten, welche Erfahrungen sie gemacht haben.
Schritt 4: Erklärt das Ergebnis
Gesunde Erwachsene haben ein Lungenvolumen von 4,2 – 6,0 Litern. Tatsächlich durch Ein- und Ausatmen bewegt werden können aber nur etwa 3,5 – 4,8 Liter, da 0,7 – 1,2 Liter Luft immer in der Lunge bleiben müssen. Beispielsweise, um zu verhindern, dass die Lungenbläschen zusammenfallen und irreversibel verkleben.
Da das Lungenvolumen abhängig von der Körpergröße ist, haben Kinder ein geringeres Lungenvolumen als Erwachsene. Mit steigendem Alter nimmt das Lungenvolumen zu, ab etwa 25 Jahren allerdings auch wieder ab (Quelle: https://www.leichter-atmen.de/lexikon-fev1).
Das Lungenvolumen ist ebenfalls abhängig vom Geschlecht und Gesundheitszustand eines Menschen. Frauen haben ein geringeres Lungenvolumen als Männer. Raucher haben ein geringeres Lungenvolumen als Nichtraucher, da die Elastizität der Lungenbläschen mit der Zeit nachlässt. Das Lungenvolumen lässt sich trainieren, Leistungsschwimmer können beispielsweise bis zu 8 Liter, Apnoe-Taucher sogar bis zu 10 Liter Luft aufnehmen.
Natürlich ist die oben beschriebene Methode zur Bestimmung des Lungenvolumens wissenschaftlich nicht hundertprozentig exakt: Es bedarf schon einiger Fingerfertigkeit, den Ballon ganz zu versenken, ohne die Finger mit ins Wasser einzutauchen. Es kann auch sein, dass beim Verknoten des Ballons etwas Atemluft entweicht. Wie schon unter „Beobachtung“ angegeben, ist es unmöglich, die Lungen vollständig zu entleeren. Das tatsächliche Lungenvolumen ist also größer als das gemessene Volumen.
Eine detailliertere Erklärung und weitere Infos findest Du in der Infobox.
Anmerkung: Du musst als Lehrperson nicht alle Antworten und Erklärungen bereits kennen. Es geht in dieser Rubrik „Ideen für den naturwissenschaftlichen Unterricht in der Grundschule“ vielmehr darum den Kindern die wissenschaftliche Methode (Frage – Hypothese – Experiment – Beobachtung/Fazit) näher zu bringen, damit sie lernen diese selbstständig anzuwenden. Ihr könnt die Antwort(en)/Erklärung(en) in einem weiteren Schritt gemeinsam in Büchern, im Internet oder durch Experten-Befragung erarbeiten.
Oft werfen das Experiment und die Beobachtung (Schritt 2 & 3) neue Fragen auf. Nimm dir die Zeit auf diese Fragen einzugehen und Schritt 2 und 3 mit Hinblick auf die neugewonnenen Erkenntnisse und mit anderen Variablen zu wiederholen. Wie sieht es z. B. mit anderen Fruchtjoghurts aus? Testet es gemeinsam!
Lade dir diese Experimentbeschreibung als vollständigen Unterrichtsentwurf oder in Kurzfassung (ohne erweiterte Experimente, Ausflugsziele, und weitere zusätzliche Infos) als PDF Datei herunter.
Autoren: Marianne Schummer und Olivier Rodesch (SCRIPT), Michèle Weber (FNR), Insa Gülzow (scienceRelations)
Redaktion: Michèle Weber (FNR)
Fotos: FNR/Yann Wirthor
Konzept: Jean-Paul Bertemes (FNR), Michelle Schaltz (FNR); Joseph Rodesch (FNR), Yves Lahur (SCRIPT)
Überarbeitung: Tim Penning, Thierry Frentz (SCRIPT)

Die Ausarbeitung dieser Rubrik wurde von science.lu in Kooperation mit dem Script (Service de Coordination de la Recherche et de l´Innovation pédagogiques et technologiques) durchgeführt.