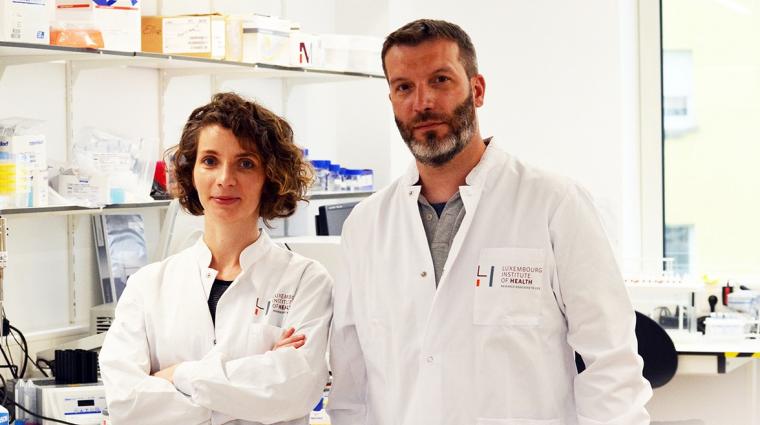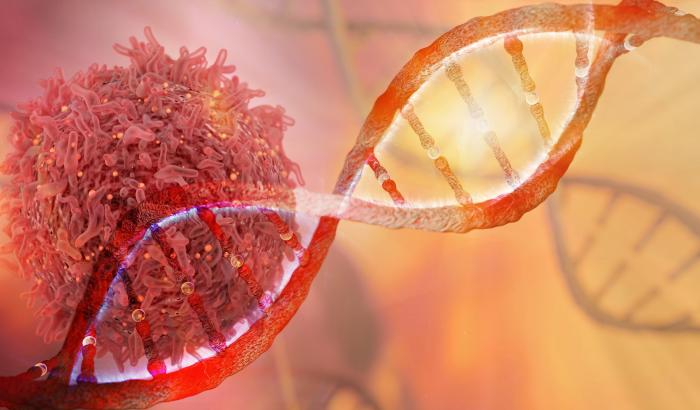(C) Hasloo/Shotshop
Früher kam die Diagnose vom Arzt, heute immer häufiger von den digitalen Helfern, die wir mit uns rumtragen. Das erleichtert vieles, birgt aber auch Risiken.
Eine Couch und ein Sessel. Auf der Couch liegt der Patient und im Sessel sitzt der Therapeut, der Fragen stellt, dem Patienten zuhört und alles notiert. Das ist das Bild, das die meisten wohl vor Augen haben, wenn sie an einen Besuch beim Psychiater oder Psychotherapeuten denken. Und wahrscheinlich kommt diese Vorstellung der Realität in den meisten Fällen auch recht nahe. Die Frage ist nur, wie lange noch.
„Wir müssen weg von dem Konzept, dass Psychotherapie automatisch Therapie und Couch bedeutet“, sagt Claus Vögele, Leiter des Instituts Health and Behaviour an der Universität Luxemburg. Der Professor und Experte für Klinische Psychologie und Gesundheitspsychologie arbeitet derzeit unter anderem an der Entwicklung Internet-basierter Psychotherapie-Programme. Und wie Vögele erklärt, stehen diese neuen Ansätze bei bestimmten Störungen oder Personengruppen der klassischen Psychotherapie in nichts nach. Im Gegenteil: „Zumindest was den Zugang angeht, schneiden Internet-Therapien sogar besser ab als persönliche Therapien, weil wir dadurch potentiell viel mehr Menschen erreichen.“
Den Gesundheitszustand viel genauer erfassen
Die Psychotherapie ist nur einer von vielen Bereichen im Gesundheitswesen, in denen sich digitale Technologien wie Apps für Computer und Smartphones oder Smartwatches integrieren lassen. Doch gerade bei der Behandlung psychischer Erkrankungen können die Programme und die dadurch gesammelten Daten sehr hilfreich sein.
„Wenn ein Patient einmal in der Woche zum Psychotherapeuten geht, dann erzählt er ihm vielleicht nur, dass es ihm schlecht geht“, sagt Vögele. „Wenn der Patient aber den Verlauf seiner Stimmung über den ganzen Tag hinweg aufzeichnet, so merkt er, dass es ihm manchmal auch gut geht“, fügt er hinzu. Mit Hilfe der erfassten Daten könne der Gesundheitszustand also viel genauer erfasst werden. Und nicht nur das. „Die Rückmeldung darüber, dass es auch mal Zeiten während eines Tages gibt, an denen es dem Patienten besser geht, ist bereits schon eine heilende Erkenntnis.“
Patienten sind gegenüber virtuellen Therapeuten offener
„Das Smartphone ist der wichtigste Sensor, weil wir damit nicht nur unseren Zustand, sondern auch sämtliche Umweltfaktoren wie das Wetter oder die Umgebung erfassen können“, erklärt Donna Spruijt-Metz vom Center for Economic and Social Research der University of Southern California. Dadurch lasse sich ableiten, inwieweit bestimmte Umweltreize den Zustand der Patienten beeinflussen.
Die Professorin aus Kalifornien, die unter anderem auch den Einsatz mobiler Gesundheitsapps bei Kindern mit Übergewicht forscht, hat kürzlich an dem von Vögele organisierten internationalen Kongress zum Thema „Digital Health“ an der Uni-Luxemburg teilgenommen. „Mit den neuen technischen Möglichkeiten erreichen wir Leute, zu denen wir sonst keinen Zugang hätten“, sagt sie. Zudem habe die Forschung gezeigt, dass Patienten gegenüber virtuellen Therapeuten oft viel offener seien als bei realen Therapiesitzungen. Und dass den Patienten bei Problemen auch viel schneller geholfen werden könne, da diese nicht erst auf den nächsten Termin warten müssten.
Nicht verlernen, auf die eigenen Körpersignale zu hören
Allerdings warnen die Forscher auch davor, sich trotz technischer Fortschritte nur noch auf Geräte zu verlassen, die einem sagen, wieviele Schritte noch zu tun sind oder wie viel noch gegessen werden darf. „Wir dürfen nicht verlernen, auf die eigenen Körpersignale zu hören“, betont Vögele. Schließlich sei die Interozeption, also die Wahrnehmung von Informationen aus dem eigenen Körper, eine der wichtigsten menschlichen Fähigkeiten. „Weil erst sie uns dazu befähigen, Emotionen zu entwickeln.“
Dem schließt sich auch Christoph Thuemmler an. Er ist Professor für E-Health an der Edinburgh Napier University und ebenfalls Teilnehmer des Kongresses. Genau wie Spruijt-Metz hat sich Thuemmler bereits mit dem Thema E-Health befasst, als es dafür noch gar keine Bezeichnung gab. „Das ist eine Revolution im Gesundheitswesen“, sagt er. „Wir müssen es nur schaffen, es wirklich einzusetzen.“
An der Technik scheitere es dabei nicht. „Es ist bereits jetzt viel mehr möglich als wir damit machen“, erklärt Thuemmler. Das eigentliche Problem sei die Sicherheit der Daten. Große Konzerne wie Google, Microsoft oder Amazon seien an diesem Thema sehr interessiert, so der E-Health-Experte. Abgesehen von den gesetzlichen Rahmenbedingungen, die dafür geschaffen werden müssten, sei es letztlich eine Frage des Vertrauens. „Die Daten zu speichern ist kein Hexenwerk“, so Thuemmler. Vielmehr gehe es darum, inwieweit man Google & Co die eigenen Daten anvertrauen wolle.
Autor: Uwe Hentschel
Foto: Hasloo/Shotshop.com