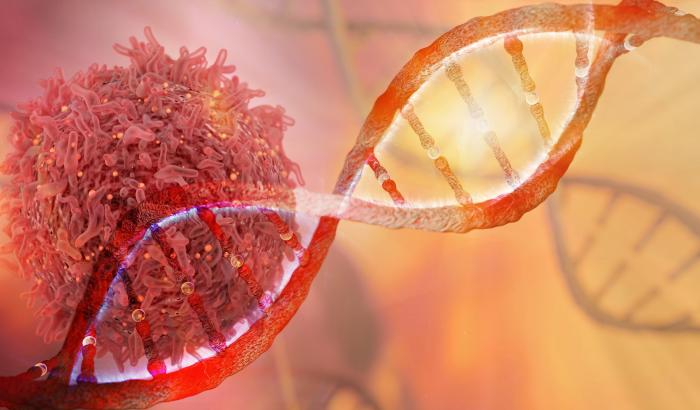Uwe Hentschel
Der Luxemburger Forscher Fernand Anton war an Experimenten beteiligt, die Vorarbeiten für die Entdeckung des Medizinnobelpreisträgers David Julius waren.
Wenn wir auf eine Chilischote beißen, brennt es im Mund. Schuld daran ist Capsaicin, eine Substanz im Chili. Doch wie verursacht Capsaicin dieses brennende Gefühl? Es aktiviert einen Sensor, der dem Gehirn normalerweise Informationen über Temperatur vermittelt. Das fand David Julius, einer der diesjährigen Nobelpreisträger in Medizin und Physiologie. Er und Ardem Patapoutian konnten unabhängig voneinander zeigen, wie Nervenimpulse ausgelöst werden, damit Temperatur bzw. Druck von unserem Körper wahrgenommen werden. "Die Arbeit der beiden Preisträger hat eines der Geheimnisse der Natur gelüftet, indem sie die molekulare Grundlage für die Wahrnehmung von Wärme, Kälte und mechanischer Kraft erklärt hat", heißt es in einer Mitteilung des Nobelkommitees. Unsere Fähigkeit, Wärme, Kälte und Berührung zu spüren, sei überlebenswichtig und unterstützte unsere Interaktion mit der Welt um uns herum.
Der Luxemburger Forscher Fernand Anton, pensionierter Professor der Universität Luxemburg, war Mitte der 80er Jahren an den Vorreiter-Experimenten zu David Julius‘ bahnbrechender Entdeckung beteiligt. Im Interview mit science.lu erinnert er sich:
FA: „Ich habe damals in Heidelberg und Erlangen mit Forschern wie z.B. Peter Reeh, Hermann Handwerker und Janos Szolcsanyi an dem Thema gearbeitet. Wir wussten damals bereits, dass es im Körper verschiedene Familien von sogenannten Rezeptoren an Nervenzellenenden gab. Das sind Sensoren, die Signale an die Nervenzelle und weiter an das Gehirn leiten können. Manche dieser Rezeptoren reagierten auf Kälte oder Hitze, andere auf Druck. Und dann gibt es noch eine ganz andere Familie Rezeptoren für Schmerzempfindung. An denen haben wir gearbeitet. Und einer der Schmerzrezeptoren, der im Körper am weitesten verbreitet war, reagiert auf Capsaicin.
Wir wussten bereits, dass Capsaicin Schmerzen auslösen konnte, aber wir wussten nicht, wie es funktionierte. David Julius hat dann Capsaicin benutzt, um das Gen zu identifizieren, dass für den Prozess nötig ist. Und es stellte sich heraus, dass es sich um einen wärmeempfindlichen Rezeptor handelt, der normalerweise bei Temperaturen aktiviert wird, die wir als schmerzhaft empfinden.“
OK, das heißt Chili brennt eigentlich gar nicht im Mund, unser Gehirn denkt das nur?
FA: „Ja. Das Capsaicin im Chili bindet auf diese wärmeempfindlichen Rezeptoren, die in unserem Mund auf Nervenzellen sitzen und wie kleine Antennen dem Gehirn vermitteln: Vorsicht, das ist heiß! Du könntest Dich verbrennen! Das Gehirn senden dann ein Schmerzsignal an den Mund zurück: „Aua, das brennt!“ Chili brennt also nicht wirklich im Mund, wir denken das nur weil Capsaicin auf einen Rezeptor bindet, der uns vor Verbrennungen schützen soll.“
Welche Bedeutung hatte die Entdeckung der Nobelpreisträger?
FA: „Wenn man den Mechanismus versteht, wie diese Rezeptoren funktionieren und Signale an das Gehirn weiterleiten, dann kann man auch versuchen, diesen Prozess zu verändern oder zu blockieren. Auf den Entdeckungen vun David Julius und auch Patapoutian baut weitere Forschung auf, die darauf abzielt Behandlungen für unterschiedliche Krankheiten und auch chronische Schmerzen zu entwickeln.
Wir wissen bereits, dass der Capsaicin-Rezeptor nach wiederholter Stimulierung desensibilisiert wird, d.h. nicht mehr auf Capsaicin reagiert. Auf diesem Wissen basieren auch Capsaicin-Salben, die z.B. Muskelschmerzen vorübergehend lindern.“
Woran haben Sie an der Universität Luxemburg geforscht?
FA: „Mit meiner Arbeitsgruppe haben wir an Schmerzempfinden geforscht. Wir haben zum Beispiel untersucht, wie Stress das Schmerzempfinden beeinflusst. Meine Kollegin Marian van der Meulen führt diese Arbeit weiter und untersucht z.B. in einer aktuellen Studie, wie unterschiedlich Schmerzen bei jungen und alten Menschen verarbeitet werden. Das übergeordnete Ziel dieser Arbeit ist es eine Grundlage für die Entwicklung von neuen schmerzlindernden Therapien zu schaffen.“
Detaillierte wissenschaftliche Hintergründe zum Medizinnobelpreis 2021 gibt es auf der Internetseite der Nobelpreise (auf Englisch).
Interview: Michèle Weber
Foto: Uwe Hentschel