
AdobeStock/Jesse B/peopleimages.com
Ergebnisse aus Umfragen liefern die Basis für Entscheidungen, Planung und Prognosen – ob in Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft.
Umfragen, Daten und Statistiken sind ein wertvolles Gut. Sie liefern die Basis für Entscheidungen, Planung und Prognosen – ob in Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft. Was macht eine glaubwürdige Umfrage aus? Und warum ist es so wichtig, an Umfragen öffentlicher Forschungsinstitute in Luxemburg teilzunehmen? Zum Weltstatistiktag sprachen wir darüber mit zwei Experten der Luxemburger Statistikgesellschaft: Guillaume Osier, Leiter der Abteilung „Conditions de vie“ beim STATEC, und die Biostatistikerin Gwenaëlle Le Coroller vom the Competence Center for Methodology and Statistics am Luxembourg Institute of Health (LIH).
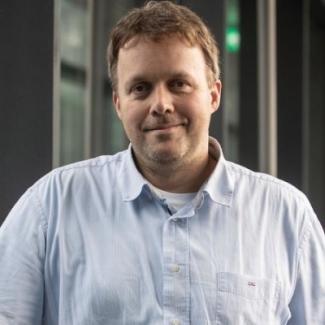

Links: Guillaume Osier (STATEC); rechts: Gwenaëlle Le Coroller (LIH)
Als Bürger hat man mitunter den Eindruck, immer häufiger für Umfragen kontaktiert zu werden. Stimmt das?
Guillaume Osier (G.O.): Ja, die Zahl der Umfragen hat in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zugenommen, denn der Bedarf an Daten und Fakten steigt. Allein der STATEC führt rund 15 Umfragen pro Jahr bei Privatpersonen sowie über 30 bei Unternehmen durch, zum Teil mit Hilfe privater Umfrageinstitute. Umfragen sind historisch gesehen eine noch junge Methode der Sozialforschung und Statistik. Erst im Zuge des Wirtschaftswachstums nach dem Zweiten Weltkrieg begann man in Europa, mit Hilfe von Umfragen wirtschaftliche Daten zu erheben und zu analysieren, die mit traditionellen volkswirtschaftlichen Datenquellen wie etwa Volkszählungen nicht erklärt werden konnten – zum Beispiel zum Kauf- und Konsumverhalten der Bürger. Denn bei Umfragen geben die Menschen selbst Auskunft, auch über ihr persönliches Verhalten und ihre Wahrnehmungen. Sie sind zentral, um zu verstehen, wie Menschen denken oder handeln. Damit liefert diese Methode einen echten Mehrwert gegenüber Informationen aus Verwaltungsdaten. Umfragen werden von Behörden wie dem STATEC, von Forschungsinstituten und Universitäten, aber auch von privaten Marktforschungsinstituten im Auftrag ihrer Kunden durchgeführt. Nach der starken Zunahme haben wir meiner Ansicht nach nun aber eine Spitze erreicht.
Zu welchen Themen werden in Luxemburg Informationen mit Hilfe von Umfragen gesammelt?
G.O.: Im Bereich der Sozialstatistiken befragt der STATEC die allgemeine Bevölkerung vor allem zu Einkommen und Lebensbedingungen sowie zu Themen, die im Zentrum der öffentlichen Debatte Luxemburgs stehen, wie die Lage auf dem Wohnungsmarkt oder der Fremdsprachenunterricht. Im Wirtschaftsbereich werden Unternehmen, Wirtschaftsexperten und Entscheidern zum Beispiel Fragen zu Gehältern, Arbeitskosten, Investitionen oder Produktivität gestellt. Ein Großteil der Anfragen kommt von Eurostat, der Statistikbehörde der Europäischen Union. Hier muss Luxemburg wie alle anderen Mitgliedstaaten nationale Daten liefern, um Ländervergleiche zu ermöglichen.
Gwenaëlle Le Coroller (G.L.C.): Umfragen spielen ebenfalls eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, Informationen über die Gesundheit der Wohnbevölkerung einzuholen. Derzeit läuft eine EU-weite Erhebung zur Gesundheit der Bürger. Da werden Krankheiten, Unfälle, gesundheitliche Einschränkungen, Teilnahme an Früherkennungsprogrammen, Krankenhausaufenthalte, Arzneimittelkonsum, Drogenkonsum, Ernährung und Sportaktivitäten sowie persönliche Einschätzungen abgefragt. Hält der Befragte seine Gesundheit für exzellent, gut, mittelmäßig, schlecht oder sehr schlecht?
So ein individuelles Feedback kann nur eine Umfrage liefern und keine Datenbank. Ziel ist, eine große Landkarte des Gesundheitsverhaltens zu zeichnen. Sie gibt Aufschluss darüber, wie häufig bestimmte Krankheiten vorkommen, wie es um den Impfschutz steht oder wie gesund die Bürger leben, und liefert mit diesen messbaren Daten eine objektive Entscheidungsgrundlage und Material für Prognosen. Das hilft Regierung und Behörden, den Bedarf nach Screening-Programmen, Vorsorgeuntersuchungen oder Aufklärungskampagnen zu ermitteln.
Finden sich noch genügend Teilnehmer oder sind die Bürger „umfragemüde“?
G.O.: Laut Gesetz ist die Teilnahme an Umfragen des STATEC oder im Auftrag des STATEC für Bürger obligatorisch (siehe Infokasten). Die Bevölkerung Luxemburgs ist klein und die Wahrscheinlichkeit, von einem Umfrageinstitut kontaktiert zu werden, hoch. Damit steigt das Risiko einer gewissen Umfragemüdigkeit. Das gilt besonders für bestimmte Zielgruppen – etwa junge Menschen. Wir versuchen deshalb, Umfragen besser zu organisieren, damit bestimmte Fragen nicht mehrmals gestellt und Bürger unnötig oft kontaktiert werden. Wichtig ist, sich die Bedeutung der Teilnahme bewusst zu machen: Die Statistik ist nichts ohne die Mitarbeit aller Bürger. Wir brauchen ein Maximum an Rücklauf. Nur so lassen sich verlässliche Daten produzieren.
G.L.C.: Es gibt insbesondere im Gesundheitsbereich weitere Umfragen und Forschungsstudien, die nicht verpflichtend sind, aber dennoch die Teilnahme der Bevölkerung benötigen. Es ist wichtig, dass der Zweck dieser Studien klar erklärt wird, um Teilnahmemüdigkeit zu vermeiden und sicherzustellen, dass der Fokus auf der Zielgruppe liegt und nicht immer dieselben Personen zur Teilnahme aufgefordert werden.
Ist die Teilnahme an STATEC-Umfragen Bürgerpflicht?
Post erhalten vom „Institut national de la statistique et des études économiques“, besser bekannt als STATEC ? Ähnlich der Wahlpflicht gibt es auch eine Teilnahmepflicht bei Umfragen des STATEC. Wer dazu aufgefordert wird, muss dies laut STATEC-Gesetz von 2011, Art.13, auch tun. Das gilt für Bürger, Unternehmen, Verwaltungen, Gemeinden und öffentliche Einrichtungen. Ausnahmen sind ausdrücklich als „fakultativ“ gekennzeichnete Erhebungen. Mit der Teilnahmepflicht will der Gesetzgeber dafür sorgen, dass genügend Menschen Auskunft geben und die Resultate repräsentativ und aussagekräftig sind. Bei Weigerung oder bewussten Falschaussagen sieht das Gesetz Geldstrafen vor. In der Praxis bleibt es bei Privatpersonen aber in der Regel bei Mahnungen oder Rückrufen.
Die Statistik ist nichts ohne die Mitarbeit aller Bürger
Guillaume Osier
Sind die Menschen genervt von Anfragen, oder gibt es noch andere Gründe?
G.L.C.: Bei der Umfragemüdigkeit spielen neben der schieren Zahl der Umfragen auch Sorgen um den Datenschutz eine Rolle. Es ist oft schwer nachzuvollziehen für die Menschen, warum bei einer Erhebung zum Gesundheitsverhalten auch Daten zum Haushalt wie etwa das Jahreseinkommen oder Beruf abgefragt werden, und sie fragen sich, was mit diesen Informationen geschieht. Ich kann versichern: Alle Fragen stehen stets in direktem Zusammenhang mit dem Ziel der Erhebung. Gesundheit hängt stark mit sozioökonomischen Faktoren wie Einkommen, Bildung und Beruf zusammen. Ohne solche Informationen könnte man Ungleichheiten nicht messen und nicht herausfinden, welche Gruppen von bestimmten Erkrankungen oder Risikoverhalten besonders betroffen sind.
Gesundheit hängt stark mit Einkommen, Bildung und Beruf zusammen. Ohne solche Informationen könnte man Ungleichheiten nicht messen
Gwenaëlle Le Coroller
G.O.: Nicht jeder Bürger kennt die Missionen der Statistikbehörde (siehe Kasten „Was ist der STATEC?“). Manche verwechseln uns mit der Finanzverwaltung und fürchten eine Steuerprüfung, wenn sie ihr Jahreseinkommen angeben. Doch man darf Umfragedaten nicht mit Steuerdaten verknüpfen. Umfragen und Studien unterliegen in Luxemburg dem Datenschutzgesetz. Mit der Nationalen Kommission für Datenschutz (CNPD) haben wir die nötigen Kontrollstrukturen. Die gesammelten Daten des STATEC oder anderer öffentlicher Forschungsinstitute dienen im Übrigen ausschließlich der Forschung, der Wirtschafts- oder Gesundheitspolitik oder anderen öffentlichen Zwecken. Sie werden nicht verkauft oder anderweitig für kommerzielle Zwecke verwendet. Wir vergeben auch keine Gutscheine oder andere Teilnahme-Anreize.
Können Sie uns Umfragen nennen, die den Menschen einen echten Nutzen gebracht haben?
G.O.: Nehmen Sie den Index, die automatische Indexierung der Löhne und Gehälter. Der Index basiert auf den Verbraucherpreisen, die anhand verschiedener Quellen ermittelt werden - darunter Haushaltsbefragungen. Die Erhebung der Haushaltsausgaben der Bürger ermöglicht es, bei der Berechnung des Index Ausgaben für Lebensmittel, Transport oder Freizeit im Warenkorb richtig zu gewichten. Die anderen EU-Staaten führen ähnliche Umfragen durch.
Ein anderes Beispiel sind unsere Umfragen zu Einkommen und Lebensbedingungen der Haushalte in Luxemburg. Demnach sind etwa 120 000 Menschen oder 18,8 Prozent der Bevölkerung von Armut betroffen. Diese Zahlen bilden die Grundlage für die Politik des Familienministeriums zur Bekämpfung der Armut. Ein Aktionsplan ist in Arbeit, und viele geplante Maßnahmen stützen sich auf die Umfrageresultate. Sie schaffen datenbasierte Evidenz, die die Politik in ihren Entscheidungen unterstützt.
G.L.C.: Die Zahlen aus der Europäischen Gesundheitsumfrage EHIS dienen der Luxemburger Gesundheitsbehörde zum Beispiel als Grundlage für Kampagnen, die die Bürger für gesündere Ernährung, mehr Bewegung und Bekämpfung von Fettleibigkeit sensibilisieren und so Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen sollen. Vergangenes Jahr stoppte der „Bus du Cœur des femmes“ in Luxemburg, um Frauen in prekären Lebenssituationen kostenlose Herz-Kreislauf- und gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen anzubieten. Es wurden auch Informationskampagnen zum Alkohol- und Tabakkonsum durchgeführt, zum Beispiel die Initiative „Zéro alcool“ oder der „No smoking challenge“.
Oder nehmen Sie die Erhebung zu Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern im Gesundheitsbereich, die 2024 vom LIH zusammen mit dem Ministerium für Gleichstellung durchgeführt wurde. Ernährungsverhalten, Zahl der Arztbesuche, Alkohol- und Zigarettenkonsum, Arbeitsunfälle, häusliche Gewalt, Krankheiten, Lebenserwartung und Todesursachen – es gibt zahlreiche Indikatoren, die klare Unterschiede zwischen Frauen und Männern aufzeigen. Die Merkmale der Gesundheit und des Verhaltens von Frauen und Männern, die diese Studie untersucht, fließen in Präventionsmaßnahmen und Gesundheitsversorgung ein.
Allerdings muss man zwischen Umfragen und wissenschaftlichen Studien unterscheiden. Am LIH führen wir wissenschaftliche Studien durch. Sie unterliegen einem spezifischen Datenschutz, müssen vom Comité national d’Ethique de Recherche (CNER) genehmigt werden, und die Resultate werden vor allem in Forschungspublikationen veröffentlicht, die für Laien schwer zugänglich sind.
Wie viele Teilnehmer sind im Allgemeinen nötig, damit eine Umfrage aussagekräftig ist?
G.L.C.: Da der Aufwand zu groß wäre und es auch zu lang dauern würde, die gesamte Bevölkerung zu befragten, wird eine Stichprobe gezogen, die alle Einwohner repräsentiert und das Verhältnis der verschiedenen Gruppen korrekt widerspiegelt, etwa den Anteil der jungen Menschen. Die Größe der Stichproben variiert je nach Ziel, Zielgruppe und notwendiger Präzision der Umfrage von einigen hundert bis mehreren tausend Personen. Besonders bei kleineren Umfragen, die sich an eine ganz bestimmte Zielgruppe richten - etwa männliche Parkinson-Patienten über 45 Jahre - zählt jede Stimme. Denn sie repräsentiert eine Minderheit und wenn diese sich Gehör verschaffen will, muss sie sich äußern.
Wann gilt eine Umfrage als „repräsentativ“?
G.O.: Man kann die Teilnehmer einer Stichprobe entsprechend dem Umfrageziel bewusst auswählen und so eine komprimierte Ausgabe der Bevölkerung mit ihren typischen Charakteristiken wie Größe der Altersgruppen, Geschlechter oder Bevölkerungsanteil nach Regionen befragen. Das ist die bekannteste Methode. Sie hat den Nachteil, dass sie nur für ein bestimmtes Ziel funktioniert.
Eine Alternative ist, Teilnehmer innerhalb einer Stichprobe nach dem Zufallsprinzip auszuwählen. Das ist die Methode des STATEC: Ein Algorithmus sucht im nationalen Register der physischen Personen Menschen per Zufall aus. Der Zufall ist das objektivste Auswahlkriterium. Ohne Zufall könnten zudem eine oder mehrere Meinungen favorisiert werden. Eine Zufallsstichprobe ist von Natur aus repräsentativ und spiegelt die Bevölkerungsstrukturen wider, wenn sie groß genug ist. Dies wird als Gesetz der großen Zahlen bezeichnet. Diese Herangehensweise ist unabhängig vom Umfrageziel. Außerdem kann man die statistischen Unsicherheiten oder Fehlerquoten dabei besser berechnen.
Werden Umfragen immer noch persönlich oder per Telefon geführt, oder vor allem online?
G.O.: Die Methoden haben sich stark weiterentwickelt. Umfragen auf Papier durch einen Interviewer, der zu den Menschen nach Hause kommt, sind selten geworden. Heute werden zunehmend Lösungen über das Internet angeboten. Man kann den Fragebogen am Computer oder über sein Smartphone ausfüllen. Ältere Menschen bevorzugen Telefon oder Papier, junge Menschen Online-Umfragen. Beim STATEC verfolgen wir multimodale Ansätze, die Internet- und Telefonumfragen kombinieren, wobei das Internet mit über 80 Prozent klar überwiegt.
Macht die Methode einen Unterschied für das Resultat?
G.L.C.: Absolut! Bei Online-Umfragen nehmen sich die Teilnehmer weniger Zeit und sind oft weniger bei der Sache. Sie lesen nicht den kompletten Text, beantworten nur die erste Hälfte der Fragen oder klicken nur auf die ersten drei von zehn Antwortmöglichkeiten. Damit steigt das Risiko, vage Daten zu erhalten. Auf Papier lesen die Teilnehmer die Fragen eher in Ruhe durch. Zudem antworten auf Papier-Fragebögen eher ältere Menschen, weil sie mit dem Internet weniger gut zurechtkommen – je nach Methode erreicht man also verschiedene Zielgruppen.
G.O.: Multimodale Umfragen bilden die Bevölkerung besser ab, liefern aber ungenauere Daten. Andererseits können auch Telefon oder persönliche Umfragen zu Verzerrungen führen. Am Telefon werden vor allem die letzten drei Antwortmöglichkeiten erinnert. Und bei persönlichen Interviews antworten die Menschen je nachdem, wen sie vor sich haben, anders. Oder sie antworten nicht ehrlich, sondern lieber mit dem, was als sozial erwünscht gilt. Das nennen wir den Erwünschtheit-Bias. Man versichert dem Interviewer beispielsweise, täglich Sport zu treiben, obwohl das nicht der Realität entspricht.
Wie gehen Sie mit diesen und anderen statistischen Unsicherheiten um?
G.O.: Es gibt keine Wundermittel. Große Stichproben können diese Unsicherheiten reduzieren, doch mit einem gewissen Maß an Unsicherheit muss die Statistik leben. Man kann sie vorhersehen und ihr Ausmaß begrenzen. So ändert sich zum Beispiel bei Online-Fragen automatisch die Reihenfolge der Antwortoptionen, damit nicht immer die ersten drei angeklickt werden. Wir versuchen zudem, die Fragen so kurz wie möglich zu halten und mit Bildern und Beispielen zu arbeiten. Früher half der Interviewers bei Unklarheiten. Heute müssen wir uns intensiver mit dem Design der Fragebögen beschäftigen, damit sie möglichst klar formuliert sind, und sie vor Gebrauch testen. Dazu kommen in Luxemburg die Übersetzungen. Die negative Konnotation eines Begriffs in einer anderen Sprache kann Antworten beeinflussen und bereitet uns mitunter Kopfzerbrechen. Wenn man etwa Personen bittet, ihren Gesundheitszustand auf einer Skala von „sehr schlecht” über „mittelmäßig” bis „sehr gut” einzuschätzen, kann die Übersetzung von „mittelmäßig” von Sprache zu Sprache einen unterschiedlichen Beiklang haben.
Kann Künstliche Intelligenz helfen, den Aufwand zu verringern?
G.O.: KI allein kann bei der Datenverarbeitung unterstützen. Wenn zum Beispiel Informationen mit Hilfe von Freitext gesammelt werden, kann KI die Texte analysieren und kategorisieren. KI ist auch ein nützlicher Assistent bei der Datenanalyse und hat unsere Produktivität gesteigert. Letztlich muss aber stets der Mensch kontrollieren.
Autorin: Britta Schlüter
Redaktion: Michèle Weber (FNR)
Infobox
Der STATEC ist die nationale Statistikbehörde Luxemburgs, auf französisch „Institut national de la statistique et des études économiques“. Die Behörde untersteht dem Wirtschaftsministerium, genießt jedoch wissenschaftliche und fachliche Unabhängigkeit. Ihre Hauptmission ist es, Statistiken, Studien und Analysen zu erstellen mit dem Ziel, ein zuverlässiges und repräsentatives Bild der wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Lage Luxemburgs zu vermitteln. Die Statistikbehörde beschäftigt rund 200 Personen und hat ihren Sitz in Belval. Studierende, Forscher und andere Interessierte können dort auch die Fachbibliothek der Behörde konsultieren. Das Statistikportal des STATEC bietet eine Fülle von Zahlen sowie verständlich aufbereiteten News und Publikationen, darunter ganz aktuell die Ausgabe 2025 von „Luxemburg in Zahlen“. Als öffentlicher Dienst stehen die Mitarbeiter Bürgern auch für statistische Auskünfte zur Verfügung. Mehr zu STATEC-Umfragen und ihrer Bedeutung in diesem Youtube-Video.
Das Luxembourg Institute of Health (LIH) ist ein öffentliches biomedizinisches Forschungsinstitut, das sich auf Präzisionsmedizin ausrichtet, mit dem Ziel, eine führende Referenz in Europa für die Umsetzung wissenschaftlicher Spitzenleistungen in einen greifbaren Nutzen für Patienten zu werden.
Das LIH stellt den Patienten in den Mittelpunkt aller seiner Aktivitäten. Angetrieben von der gemeinschaftlichen Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft, sollen Wissen und Technologien, die aus der Forschung an patienteneigenen Daten stammen, genutzt werden, um einen direkten Einfluss auf die Gesundheit der Bevölkerung zu haben. Seine engagierten Teams aus multidisziplinären Forschenden streben nach Exzellenz und generieren relevantes Wissen im Zusammenhang mit immunbezogenen Krankheiten und Krebs.
Das Institut setzt auf Kooperation, zukunftsweisende Technologien und Prozessinnovationen als einzigartige Möglichkeiten zur Verbesserung der Anwendung von Diagnostika und Therapeutika mit dem langfristigen Ziel, Krankheiten vorzubeugen.








