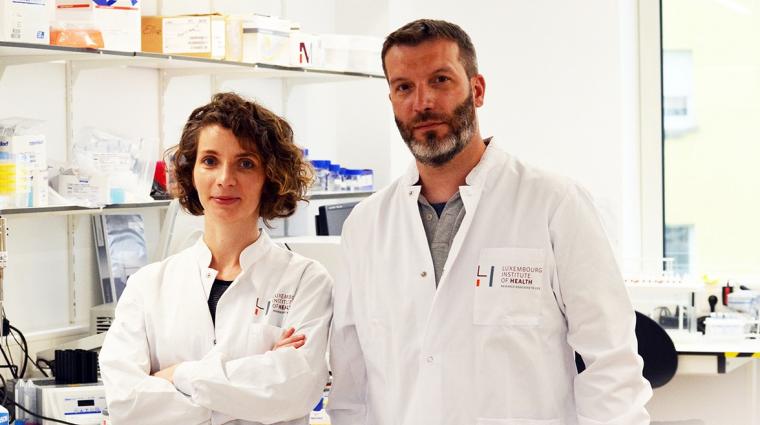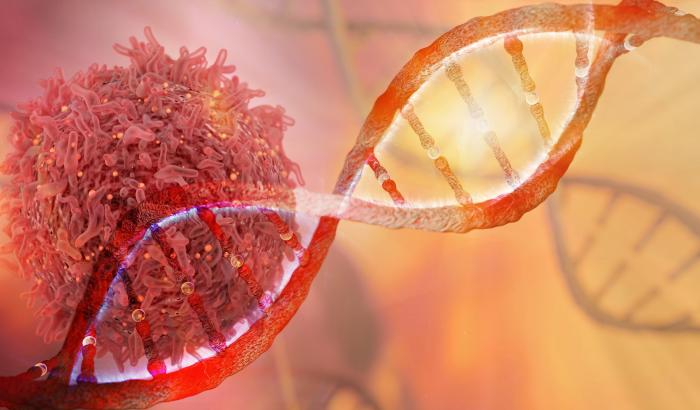(C) Philip Birget
Herr Birget, jährlich sterben fast eine Million Menschen an Malaria, der Krankheit, die Sie erforschen. Entwickeln Sie gegen den Erreger neue Medikamente?
Nein, unser Labor verfolgt einen anderen, ökologischen, Ansatz. Wir betrachten den Malaria-Parasiten als Organismus in seinem Lebensraum – ebenso, wie man dies in der Ökologie auch bei größeren Tieren macht. Wie versuchen zu verstehen, wie die Parasitenpopulation mit ihrer Umwelt – also dem Wirt – interagiert, wie sie Ressourcen nutzt oder sich gegenüber anderen Erregern verhält, die den Wirt zeitgleich infiziert haben.
Eine wesentliche Frage meiner Doktorarbeit ist: Wie verändern die Erreger ihr Verhalten bezüglich der Krankheitsübertragung in Reaktion auf bestimmte Bedingungen innerhalb des Wirtes. Und wie schaffen es die Parasiten sich in ihrem Wirt bestmöglich zu vermehren, ohne ihn gleichzeitig zu töten.
Was ist der Vorteil dieses Ansatzes?
Wenn man ausschließlich auf neue Medikamente setzt, hat das einen entscheidenden Nachteil: Resistenzen gegen diese Medikamente entwickeln sich ausgesprochen schnell. Sobald ein neues Mittel auf dem Markt ist, tauchen auch schon die ersten Resistenzen auf. Es ist daher äußerst wichtig herauszufinden, wie sich die Parasitenpopulationen derart schnell auf die Medikamente einstellen können. Außerdem können wir mit unserer Forschung herausfinden, wann die Krankheit besonders schnell übertragen wird.
Was haben Sie herausgefunden und was sind die Konsequenzen hieraus?
Vor allem anämische – also blutarme – Patienten übertragen Malaria besonders effektiv und sind hochinfektiös. Man sollte gerade diese Patienten also von den Überträgern der Krankheit, Moskitos, fernhalten.
Sie forschen aber nicht direkt am Menschen…
Das ist richtig; unsere Modellorganismen sind Mäuse. Diese infizieren wir mit Malariastämmen, die ein Forscherteam bereits in den Fünfziger-Jahren im Kongo isoliert hat. Die Nager sind hierfür ein sehr gutes Modell, denn bei ihnen können wir die verschiedenen Stadien in der Parasitenentwicklung sehr gut verfolgen. Das Tierexperiment ist nötig, weil wir die Entwicklung des Parasiten im gesamten Organismus untersuchen – nicht etwa wie bei Medikamententests, bei denen man auch auf Versuche mit Zellkulturen ausweichen kann. Aber auch wir arbeiten inzwischen mit Zellkulturen, um in Zukunft vielleicht eine Alternative zum Tierversuch zu haben.
Das klingt nach gefährlicher Laborarbeit mit hochinfektiösem Material…
Nein, eine Gefahr für uns Wissenschaftler besteht nicht, denn die Malariastämme mit denen wir arbeiten sind nur für Mäuse gefährlich. Die größte Gefahr besteht darin, mal von einem Moskito gebissen zu werden – erkranken können wir daran aber nicht.
Vor Ihrer Doktorarbeit haben Sie Vögel studiert.
Genau. In meiner Bachelorarbeit habe ich Malaria in Spatzen untersucht und Vögel im peruanischen Regenwald. Die Unterscheide sind aber nicht so groß, wie sie zunächst scheinen: Ich erforsche noch immer, wie Populationen ökologisch funktionieren. Früher im Dschungel und heute im Labor.
Autor: Tim Haarmann
Foto: Philip Birget
Infobox
Philip Birget schreibt an der Universität Edinburgh seine Doktorarbeit in der Gruppe von Prof. Sarah Reece und wird darin durch ein Stipendium des FNR unterstützt. In seiner Bachelorarbeit hat der Biologe Malaria-Erkrankungen tropischer Vögel im Regenwald von Peru untersucht und während seiner Masterarbeit mathematische Modelle entworfen, mit denen er berechnen konnte, wie sich Malaria-Resistenzen entwickeln.