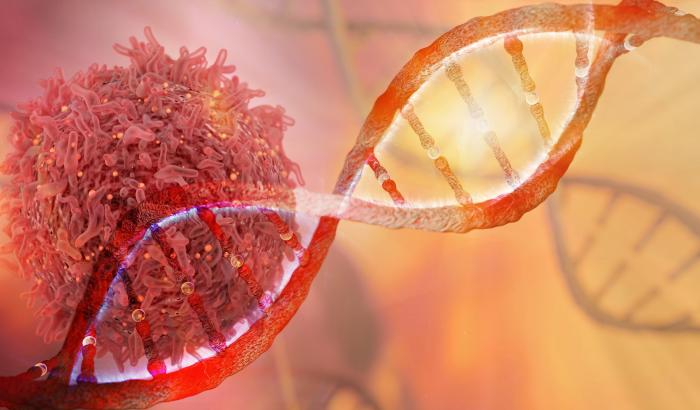(C) Uwe Hentschel
Stephen Senn est directeur du Centre de Compétences de la Méthodologie et des Statistiques du Luxembourg Institute of Health
Führen klinische Studien zu Extremwerten, so liegen darauffolgende Messungen oft wieder näher am Mittelwert - ein statistisches und unterschätztes Phänomen.
Wachstumsrechner, von denen es im Internet unzählige gibt, sind eine feine Sache. Man gibt einfach die Größe der Mutter und des Vaters an, ergänzt dann noch das Geschlecht des Kindes und schon erfährt man, wie groß der Sohn oder die Tochter voraussichtlich wird. Sind beide Eltern ungewöhnlich groß, so wird der Sohn noch größer und die Tochter je nach Größendifferenz der Eltern zumindest größer als die Mutter. In vielen Fällen trifft das später auch zu. Doch wäre es die Regel, so wären wir inzwischen umgeben von Riesen. Dass aber genau das nicht der Fall ist, liegt an der so genannten Regression zur Mitte (Regression to the mean).
Die Regression zur Mitte ist ein Begriff aus der Statistik. Beschrieben wird damit das Phänomen, dass bei einem extrem ausgefallenen Messwert der nächste Messwert wieder näher am Mittelwert liegt. Im Eingangs erwähnten Beispiel sorgt dieser Effekt also dafür, dass die Kinder extrem großer Eltern statistisch gesehen näher an der Durchschnittsgröße liegen als deren Eltern. Und genauso gilt diese Regression zur Mitte auch in die andere Richtung: So bewegen sich die Eltern überdurchschnittlich großer Kinder näher an der Durchschnittsgröße als ihre Nachwuchs.
Phänomen bei klinischen Studien oft missachtet
„Es ist schwierig, das zu verstehen, doch gibt es dafür eine rein mathematische Erklärung“, sagt Stephen Senn, Leiter des Kompetenzzentrums für Methodik und Statistik am Luxembourg Institute of Health (LIH). Senn hat sich in wissenschaftlichen Arbeiten bereits mehrfach mit der Regression zur Mitte befasst. Und daher kennt er nicht nur den Effekt, sondern weiß auch, dass dieser gerade bei klinischen Studien oft missachtet wird - mit der Folge, dass es zu einer Verfälschung des Behandlungseffekts kommt.
Ein Beispiel: In einer Studie soll ein Medikament zum Senken des Blutdrucks getestet werden. Dafür wird zunächst bei allen Personen der Blutdruck gemessen, um daraus dann die Teilnehmer auszusuchen, die aufgrund ihres zu hohen Blutdrucks für den Test infrage kommen. Diesen Personen wird dann das Medikament verabreicht. Zu einem späteren Zeitpunkt wird der Blutdruck erneut gemessen. Ist der Blutdruck bei dieser zweiten Messung deutlich tiefer und trifft das für den größten Teil der Probanden zu, so könnte man daraus schließen, dass das Medikament wirkt.
Ungenaue Ausgangslage führt zwangsläufig zu Effekten
Für Stephen Senn jedoch offenbart sich schon bei der Auswahl der Teilnehmer das Problem. „Für einen zu hohen Bluthochdruckwert kann es viele Gründe geben“, sagt er. Das könne an der Genetik oder aber der Ernährungsweise liegen, ebenso aber auch an der Tagesform oder aber an einem Messfehler beziehungsweise einer falsch sitzenden Blutdruckmanschette. Durch diese ungenaue Ausgangslage komme es bei einer zweiten Messung zwangsläufig zu Veränderungen. Gemäß der Regression zur Mitte hat man also bei der ersten Messung eine Vielzahl an Extremwerten, denen dann bei der zweiten Messung Werte folgen, die wieder näher am Normbereich liegen.
Um herauszufinden, ob das Medikament wirklich wirkt, müsse man deshalb die Personen nach dem Zufallsprinzip in eine Test- und eine Kontrollgruppe aufteilen, erklärt der Statistik-Professor. Komme es dabei in der Studiengruppe zu einer durchschnittlich deutlich höheren Absenkung des Blutdrucks als in der Kontrollgruppe, so ließe sich das dann tatsächlich mit der Wirkung des Medikaments begründen.
Autor: Uwe Hentschel
Foto: Uwe Hentschel