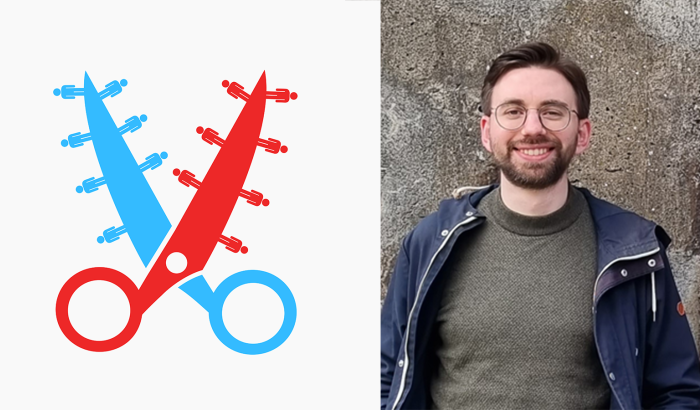(C) University of Luxembourg
„Wenn wir Integration als Prozess sehen, der das Ziel hat, am sozialen und ökonomischen Leben eines Landes teilzunehmen, dann müssen wir Sprache als Kommunikationsvehikel verstehen“, so die neuseeländische Soziolinguistin, die seit 2009 an der Universität Luxemburg lehrt und forscht: „In einem mehrsprachigen Land bedeutet das, dass mehrere sprachliche Wege ans Ziel führen können.“
Individuelle Faktoren entscheiden
Das jeweilige soziale Umfeld spielt dabei im individuellen Fall ebenso eine Rolle wie die Motivation oder das Alter der Person, so Julia de Bres: „Bei Kindern, die neu nach Luxemburg kommen, kann es sehr sinnvoll sein, wenn sie Luxemburgisch lernen, während es für einen Erwachsenen mit Blick auf das Berufsleben in vielen Fällen sinnvoller sein mag, zunächst Französisch zu lernen.“
Letzteres schließe übrigens nicht aus, dass besagter Erwachsender dann später von sich aus das Bedürfnis entwickelt, Luxemburgisch zu lernen: „Wer sich z.B. mit seiner portugiesischen Muttersprache oder mit Hilfe des Englischen ein soziales Netzwerk aufgebaut hat, der wird vielleicht Lust bekommen, Luxemburgisch zu lernen, um sich hier noch etwas wohler zu fühlen.“
Integration als flexibles Konzept
In jedem Falle hätten ihre eigenen Studien zu Sprache und Integration diese Ergebnisse erbracht, so Julia de Bres (siehe Infobox) – wobei sie den Begriff „Integration“ neuseeländisch definiert: „In Neuseeland als Einwanderungsland bedeutet Integration ein flexibles Konzept, während in Europa oftmals von dann Integration die Rede ist, wenn eigentlich Assimilation gemeint ist.“
Bei derlei „gleichmacherischen“ Ansätzen spiele der Faktor Landessprache eine wesentliche – eine exkludierende Rolle –, so Julia de Bres weiter: „Nach wie vor wird das Erlernen der Landessprache oft mit Integration gleichgesetzt, was einer veralteten Denkweise entspringt und zudem außer Acht lässt, dass es weit mehr bedarf als nur Sprachkenntnisse, um in einer Gesellschaft anzukommen.“
Realitätsnahes Modell entwickeln
Echte Integration hingegen sei ein vielschichtiger Prozess, und gerade in einer mehrsprachigen Gesellschaft wie Luxemburg sei zudem die damit einhergehende Sprachfrage komplexer als anderswo. Auch vor diesem Hintergrund sieht sich Julia de Bres auf einem außerordentlich spannenden akademischen Neuland angelangt, was ihre Forschungsarbeit hierzulande angeht.
Dieses Neuland „beackert“ sie mit einem dynamischen Modell: „Die existierenden Modelle sind statisch und spiegeln nur bedingt die Realität wieder. Das gilt sowohl für die oft postulierte dreisprachige Gesellschaft als auch für den identitätslastigen einsprachigen Ansatz. Unser Ziel ist es, ein Modell zu entwickeln, das alle kulturellen Einflüsse in allen Lebensbereichen berücksichtigt.“
Autor: Sven Hauser
Foto © uni.lu
Infobox
In einer im Jahr 2009 durchgeführten Studie hat Julia de Bres sich mit den Gründen auseinander gesetzt, die Grenzgänger dazu bewegen, Luxemburgisch zu lernen. Dabei kam heraus, dass dem sowohl eine sogenannte instrumentelle Motivation als auch eine integrative Motivation zugrunde lag. Erstere steht für den Wunsch zu verstehen und verstanden zu werden, letztere ist als Ausdruck von Respekt und Freundlichkeit zu verstehen. Laut Julia de Bres sind dies menschliche Aspekte, die auch bei in Luxemburg wohnenden Ausländern eine Rolle spielen.