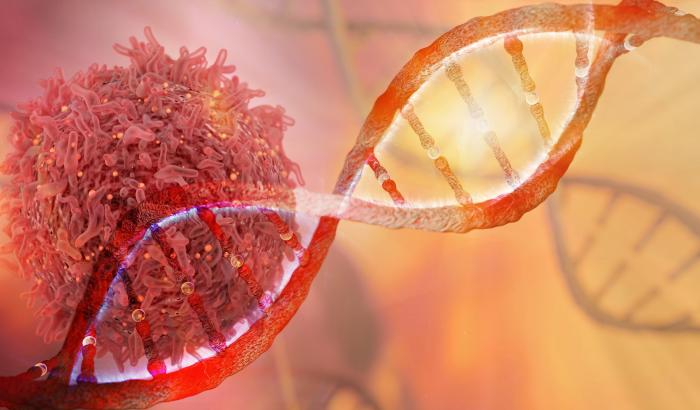(C) Michel Brumat / University of Luxembourg
Enrico Glaab identifizierte das USP9-Gen.
Wissenschaftler der Uni Luxemburg haben ein Gen identifiziert, das einen neuen Ansatzpunkt zur Entwicklung von Alzheimer-Therapien bieten könnte.
Kennzeichnend für die Alzheimer-Erkrankung ist die fortschreitende Zerstörung von Nervenzellen und Nervenzellkontakten. Die Gehirne von Alzheimer-Kranken weisen Eiweißablagerungen auf, so genannte Amyloid-Plaques. Folge der Krankheit sind Gedächtnis- und Orientierungsstörungen, Sprachstörungen, Störungen des Denk- und Urteilsvermögens sowie Veränderungen der Persönlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit an Alzheimer zu erkranken, steigt mit dem Alter drastisch an. Daher wächst die Zahl der betroffenen Menschen aufgrund der steigenden Lebenserwartung stetig. Weltweit sind derzeit schätzungsweise 35 Millionen Menschen an Alzheimer erkrankt. Bis 2030 könnte ihre Zahl auf rund 65 Millionen, bis 2050 auf über 100 Millionen steigen.
Wie die Krankheit entsteht, ist bis heute nicht vollständig geklärt. Vermutlich spielen aber molekulare Fehlentwicklungen in den Hirnzellen eine entscheidende Rolle, an denen unter anderem Tau-Proteine beteiligt sind. Sie lagern sich bei Alzheimer-Patienten in Bündeln aus fadenartigen Strukturen, den Neurofibrillen, zwischen den Hirnzellen ab und stören ihre Funktion.
Proben aus den Gehirnen von rund 650 verstorbenen Menschen analysiert
„Das Risiko, Alzheimer zu bekommen, ist bei Frauen im fortgeschrittenen Alter deutlich höher als bei Männern – selbst, wenn man die im Schnitt höhere Lebenserwartung von Frauen berücksichtigt“, sagt Enrico Glaab, Leiter der Forschungsgruppe Biomedical Data Science am Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB). Für ihn war diese Erkenntnis ein Hinweis, nach molekularen Differenzen zwischen den Geschlechtern zu suchen, die zu den Unterschieden bei Häufigkeit und Ausprägung der Krankheit beitragen. Dazu analysierte er mit seinem Team Tausende Datenreihen zu Proben aus den Gehirnen von rund 650 verstorbenen Menschen beiderlei Geschlechts, von denen einige an Alzheimer erkrankt waren und andere nicht.
Die Forscher stießen auf ein Gen, das als wichtiger Einflussfaktor für die geschlechtsspezifischen Unterschiede in Bezug auf Alzheimer infrage kommt. Das Gen namens Ubiquitin-spezifische Peptidase 9 (USP9) beeinflusst die Aktivität eines Gens, welches das Tau-Protein kodiert (Mikrotubuli-assoziertes Protein Tau, MAPT). MAPT wiederum ist vermutlich stark an Entstehung der Alzheimer-Krankheit beteiligt.
Um die Wirkungsweise von USP9 sowie den Zusammenhang zwischen seiner Funktion und der Rolle des Tau-Proteins in Alzheimer zu untersuchen, nahm Enrico Glaab gemeinsam mit Kollegen aus anderen Arbeitsgruppen des LCSB das Gen in Zellkulturen und bei Versuchen mit Zebrafischen unter die Lupe. Dazu blockierten die Wissenschaftler die Aktivität von USP9 und maßen die Auswirkung dieses „Knockdowns“ auf die Gen-Aktivität von MAPT in den beiden Modellsystemen Zellkultur und Zebrafisch.
Noch ein weiter Weg bis zu möglichen Medikamenten
„Wir konnten zeigen, dass eine Inaktivierung von USP9 die Aktivität des Tau-Gens in beiden Modellen signifikant verringert“, berichtet Glaab. Das Gen könnte daher einen Angriffspunkt für künftige Wirkstoffe zur Modulation von Tau bieten – auch wenn der Weg bis zu möglichen Medikamenten gegen Alzheimer, die darauf basieren, noch weit ist.
Für ein genaueres Verständnis der molekularen Signalkette, die USP9 und MAPT verbindet, haben die Forscher am LCSB nun ein Computermodell entwickelt, das die gemessenen Daten mit bekannten regulatorischen Informationen aus der Literatur verbindet. Dabei stellten sie fest, dass sich Proteine, die bereits als mögliche Arzneistoffziele vorgeschlagen wurden, ebenfalls durch USP9 beeinflussen lassen. Durch einen parallelen Eingriff bei mehreren Tau-Regulatoren könnte USP9 als pharmakologisches Zielprotein daher einen größeren Effekt haben als die bisher diskutierten Zielproteine.
Das Forschungsprojekt wurde finanziert mit dem Preisgeld, das Enrico Glaab 2013 bei einem weltweit ausgeschriebenen Data-Mining-Wettbewerb der Geoffrey Beene Foundation errang, einer US-amerikanischen Stiftung mit Sitz in New York. Ihre Erkenntnisse haben die Wissenschaftler kürzlich in der Fachzeitschrift Molecular Neurobiology veröffentlicht.
Autor: Universität Luxemburg
Foto © Michel Brumat / Universität Luxemburg