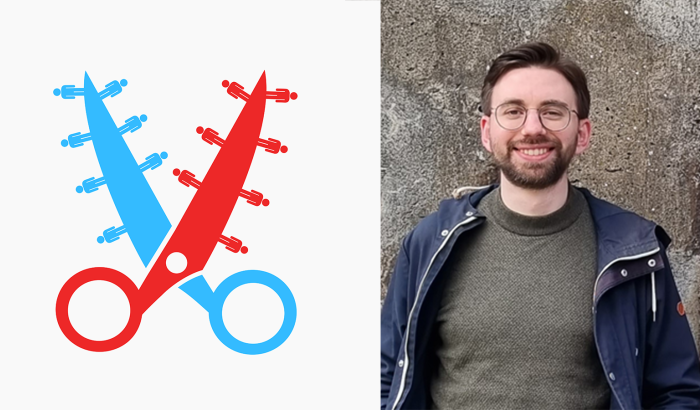(C) Uwe Hentschel
Georg Mein, Professor für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Luxemburg und zudem Dekan der Fakultät für Sprachwissenschaften und Literatur, Geisteswissenschaften, Kunst und Erziehungswissenschaften
Das, womit sich die Humanwissenschaft beschäftigt, ist der Mensch. Den jedoch beschäftigt nicht selten die Frage, warum sie das eigentlich tut.
Aus dem Dilemma, in dem sich seine Wissenschaft befindet, macht Georg Mein keinen Hehl. „Wir stehen ein Stück weit unter Druck“, sagt er. Auf der einen Seite werde von den Geistes- und Sozialwissenschaften ein Beitrag für die Gesellschaft erwartet, auf der anderen Seite aber werde die humanwissenschaftliche Forschung vergleichsweise wenig gefördert.
Mein ist Professor für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Luxemburg und zudem Dekan der Fakultät für Sprachwissenschaften und Literatur, Geisteswissenschaften, Kunst und Erziehungswissenschaften. Als solcher hat er im Herbst an der Uni die internationale Fachkonferenz „The Ends oft the Humanities“ organisiert. Die Mehrdeutigkeit des englischen Wortes „Ends“ erlaubt bewusst verschiedene Interpretationen: Ends im Sinne von Ende, aber auch Ends in der Bedeutung von Ziel oder Zweck.
Wer sonst liefert Antworten auf populistische Strömungen und Donald Trump?
Was letzteres betrifft, so haben es die Geisteswissenschaften in der Vergangenheit versäumt, das zu formulieren. Das zumindest behauptet Hans Ulrich Gumbrecht, Teilnehmer und Referent der Konferenz. Der Dozent für Vergleichende Literaturwissenschaft an der Stanford University in Kalifornien sieht ein wesentliches Problem der Geisteswissenschaften darin, selbst zu erkennen, wo die eigenen Stärken und Potenziale liegen.
Und dort, wo sie erkannt werden, scheitert es dann mitunter an einem weiteren Problem: der Vermittlung. Die Geisteswissenschaften müssten viel aktiver kommunizieren, ihr Wissen mit der Gesellschaft teilen, um so den gesellschaftlichen Nutzen hervorzuheben, sagt Mein. „Wenn man sich über populistische Strömungen und Menschen wie Donald Trump aufregt, gleichzeitig aber den Geisteswissenschaften ihre Relevanz abspricht, dann läuft doch was schief “, meint der Dekan.
Die aktuellen Debatten seien geprägt von Themen wie Populismus, Flüchtlingsintegration, soziale Gerechtigkeit oder Bildung. Und wenn ein Wissenschaftsbereich in der Lage sei, faktenbasierte Lösungsansätze für diese gesellschaftlichen Herausforderungen zu liefern, so seien das doch wohl am ehesten die Geistes- und Sozialwissenschaften, ist Mein überzeugt. „Unsere Aufgabe besteht darin, in einer immer komplexer werdenden Wirklichkeit Orientierungswissen zu vermitteln“, sagt er.
Auch Geisteswissenschaftler sollten verstehen, wie ein Algorithmus funktioniert
„Die Vergegenwärtigung der Vergangenheit hilft uns, Probleme der Gegenwart für die Zukunft zu lösen“, fasst Dekan Mein den Auftrag seines Fachbereichs zusammen. Daran habe sich im Grunde bis heute nicht viel geändert - nur dass der Zugang zum Fachwissen heute viel leichter sei. „Die Sinn-Frage der Geisteswissenschaften hat sich im 19. Jahrhundert gar nicht gestellt“, sagt er. Damals seien die Absolventen der Humanwissenschaften Bestandteil der kleinen, gebildeten Schicht gewesen. „Doch dieser Kreis der Gebildeten ist längst verschwunden“, so Mein.
„Früher bestand elitäres Wissen schon darin, Lesen und Schreiben zu können“, sagt er. „Heute bedeutet elitäres Wissen, Algorithmen entwickeln zu können.“ Und genau das sei einer der Punkte, wo er für die Humanwissenschaften dringenden Nachholbedarf sehe. „Ich finde es essenziell zu verstehen, wie ein Algorithmus funktioniert. Um beispielsweise auch nachvollziehen zu können, warum bei meiner Suche im Internet immer ganz bestimmte Werbung auftaucht.“
Humanwissenschaftler müssen bisherige Grenzen überschreiten
Der Uni-Dekan könnte sich deshalb ein allgemeines Unterrichts-Modul zur Code-Programmierung vorstellen. „Dass wir von Nerds beherrscht werden, beunruhigt mich schon ein wenig“, sagt der Literaturwissenschaftler, der aber nicht nur von den Informatikern lernen will, sondern im Gegenzug auch ein Humanities-Modul für die Studierenden aller Fachbereiche entwickeln möchte. „Das soll jetzt keine Einführung in die Philosophie werden oder ähnliches, sondern ein Angebot, dass für Jura-Studenten genauso interessant ist wie für Mathematiker.“
Es wird und muss sich einiges ändern. In einer existenzbedrohenden Krise sieht Mein die Humanwissenschaften aber nicht. Auch nicht, was die Zukunftsaussichten derjenigen betrifft, die in diesem Bereich studieren. „Wir haben festgestellt, dass unsere Absolventen in der Regel schnell einen Job finden“, sagt er. Mein nennt als Beispiel eine Doktorandin, die sich bei ihrer Promotion mit Holocaust-Literatur befasst habe und jetzt sehr erfolgreich als Unternehmensberaterin tätig sei.
Es sei wichtig, bisherige Grenzen zu überschreiten, einen Blick über den Tellerrand zu werfen – gerade im Bereich der Humanwissenschaften, ist der Dekan überzeugt: „Wenn Geistes- und Sozialwissenschaftler ihr Heil nur darin suchen, an der Vergangenheit festzuhalten, dann werden sie untergehen.“
Autor: Uwe Hentschel
Foto: Uwe Hentschel