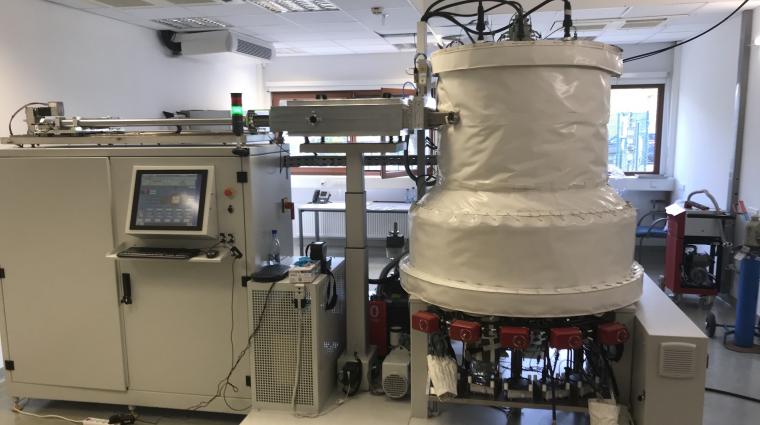© Shotshop
Nicht nur die Dächer, sondern auch die Fassaden sind für Fotovoltaik-Anlagen geeignet.
Es ist durchaus sinnvoll, gerade dort nach Möglichkeiten der regenerativen Energieerzeugung zu suchen, wo auch die meiste Energie verbraucht wird, nämlich in den Städten. Diesen Ansatz verfolgt auch das vor vier Jahren gestartete und inzwischen beendete SECuRe-Projekt (Smart Energy Cities and Regions) am Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST). Ziel des von der ENVOS Fondation maßgeblichen finanzierten Projekts ist die Erstellung eines Online-Tools. Diese soll einerseits Energieeinsparpotenziale in den Städten und andererseits auch die Möglichkeiten der Stromerzeugung durch Solarenergie aufzeigen.
Detaillierte Angaben für jeden Quadratmeter Fassade und Dach
Die LIST-Forscher nutzten dazu als Grundlage einen bereits in einem vorherigen Projekt erstellten 2D-Algorithmus zur Ermittlung von Dachflächen für Fotovoltaik und entwickelten daraus dann eine 3D-Simulation am Beispiel von Esch-sur-Alzette. Zu den Besonderheiten dieses Algorithmus‘ zählt dabei, dass neben der Einbeziehung von Gebäudefassaden auch die Veränderung des Sonnenstands oder aber der Schatten durch andere Gebäude, Bäume und topografische Gegebenheiten berücksichtigt wurde. Und das bezogen auf das ganze Jahr. So lassen sich für jeden Standort recht detaillierte Angaben zur Effizienz möglicher Fotovoltaik-Anwendungen machen.
Aus mehr als 12.000 einzelnen, kleinen Karten wurde dabei eine große 3D-Karte erstellt. Allein für die Stadt Esch waren bei der Verarbeitung sämtlicher Parameter drei Milliarden Rechenschritte erforderlich. Entsprechend hoch ist auch die Auflösung, die die Potenziale auf jedem einzelnen Quadratmeter Fassade und Dachfläche zeigt. Ergänzend dazu wurden auch der Energieverbrauch von Gebäuden und die Möglichkeiten der Optimierungen miterfasst.
Modell lässt sich auch auf andere Städte übertragen
„Der Energiebedarf wird sich bis 2050 verdoppeln, während der Anteil der erneuerbaren Energien bis 2035 auf 50 Prozent steigen soll“, sagt LIST-Forscher Ulrich Leopold, Verantwortlicher des SECuRe-Projekts. „Wir brauchen also sehr detaillierte und präzise Informationen, damit wir den Unternehmen und auch den politisch Verantwortlichen dabei helfen können, neue Möglichkeiten der Erzeugung erneuerbarer Energien in den Städten voranzutreiben und den CO2-Ausstoß zu reduzieren“, so Leopold. Dabei helfe die Plattform. Das Tool zeige für jedes Gebäude den Energiebedarf und die Möglichkeiten des Einsatzes von Solarenergie.
Zu den zukünftigen Nutzern dieses Angebots, für das sich Nutzer zunächst registrieren lassen müssen, sollen unter anderem Stadtplaner gehören. Diese können daraus dann Vorschläge für eine energetische Sanierung von Gebäuden oder aber die optimale Installierung und Ausrichtung von Fotovoltaikanlagen ableiten könnte, wie Leopold erklärt. So zeige die Simulation am Beispiel Esch-sur-Alzette, dass dort an den Fassaden und Dächern insgesamt bis zu 40 Gigawatt erzeugt werden könnten, womit sich ein Großteil des Energiebedarfs der Stadt abdecken ließe. Zudem sei das Modell so angelegt, dass es sich – sofern die entsprechenden Daten vorlägen – auch auf jede andere Stadt übertragen ließe. So gebe es bereits einen Testlauf mit Diekirch, aber auch Interesse von Städten außerhalb Luxemburgs wie beispielsweise Berlin oder Zürich.
CO2-Ausstoß in 30 Jahren um 90 Prozent reduzieren
Für Luxemburg ist das Projekt ein Baustein, um die ambitionierten Ziele des nationalen Energie- und Klimaplans zu erreichen. Bis 2030 soll der CO2-Ausstoß um 55 Prozent reduziert, der Energieverbrauch ebenfalls um mindestens 40 Prozent gesenkt und gleichzeitig der Anteil erneuerbarer Energien um 25 Prozent gesteigert werden. Darüber hinaus gehört Luxemburg auch zu den Staaten, die das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 unterzeichnet haben. Die damit verbundene Verpflichtung ist, alles dafür zu tun, dass die Klimaerwärmung unter zwei Grad bleibt.
„Uns bleiben 30 Jahre, um den CO2-Ausstoß um 90 Prozent zu reduzieren, und um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir bahnbrechende Innovationen“, sagt dazu LIST-Geschäftsführer Thomas Kallstenius. Ähnlich sieht das Energieminister Claude Turmes, fordert gleichzeitig aber auch ein gesellschaftliches Umdenken. „Technik und Forschung allein reichen nicht aus, um die Klimaerwärmung auf unter zwei Prozent zu halten“, so der Minister. Das Erreichen der Klimaziele sei nicht nur eine politische und wissenschaftliche Aufgabe, sondern vor allem eine gesellschaftliche.
Autor: Uwe Hentschel