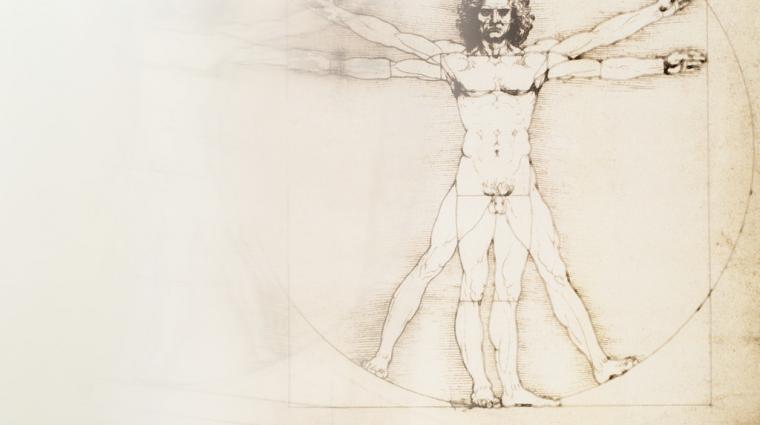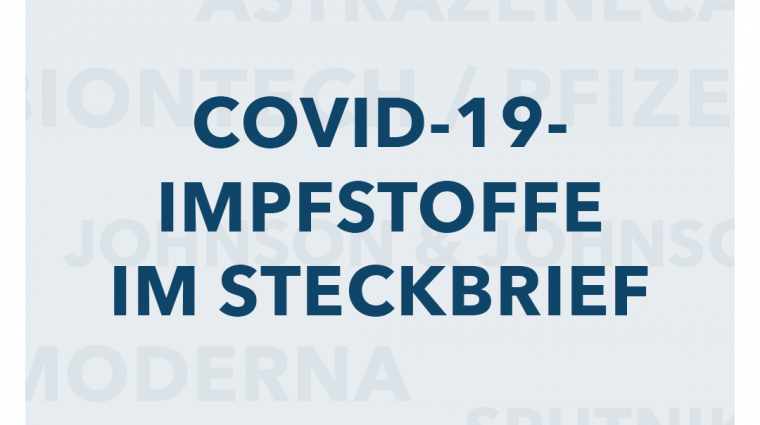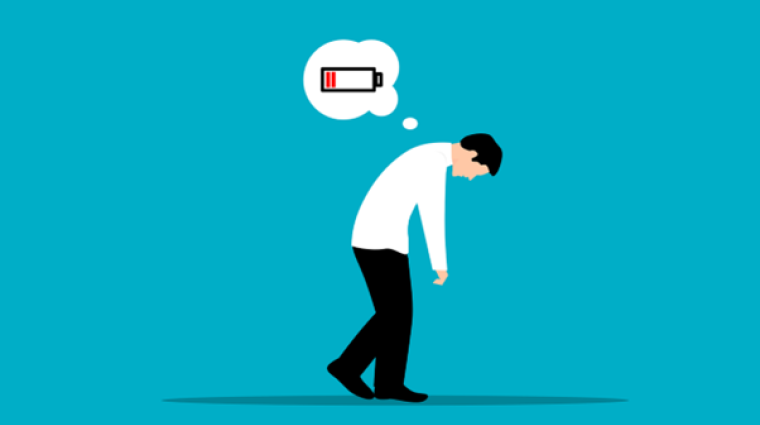Science Relations
In normalen Zeiten dient wissenschaftliche Evidenz als Grundlage für neue Hypothesen und Innovationen, und idealerweise auch für politische Entscheidungen. Der Prozess dahinter blieb aber meist den Wissenschaftlern und eventuell Politikern oder anderen Interessierten vorbehalten. In der Corona-Krise werden wir plötzlich alle damit konfrontiert. Wissenschaftler stehen im Rampenlicht und fast täglich werden politische Entscheidungen getroffen, die unser Leben stark beeinflussen - auf Basis von vorhandener oder nicht vorhandener wissenschaftlicher Evidenz...
Wie überträgt sich denn nun das Virus? Eher über Aerosole, oder eher über Schmierinfektion? Sind Masken denn nun nützlich, oder ist dies wissenschaftlich noch nicht bewiesen? Weshalb wurde anfangs AstraZeneca nicht für ältere Menschen empfohlen und nun ist das Gegenteil der Fall?
Infobox
Jeder kann eine Meinung haben, und diese als Behauptung formulieren und versuchen, sie mit Argumenten zu untermauern. Wissenschaftler stellen auch Behauptungen auf. Sie nennen das eine „Hypothese“. Aber in der Wissenschaft muss jede Behauptung durch sogenannte Evidenz unterstützt werden. Das bedeutet: es gibt Nachweise, die durch anerkannte, wissenschaftliche Methoden systematisch erhoben und kritisch evaluiert wurden - und die die Hypothese unterstützen, helfen diese zu verfeinern oder eben zu widerlegen.
Diese Suche nach wissenschaftlicher Evidenz ist ein kontinuierlicher Prozess, der zum Alltag jedes Wissenschaftlers gehört. Es ist ein Prozess der Wahrheitsfindung, bzw. eine Suche nach gesichertem Wissen, bei dem sich eine „Wahrheit“ bzw. gesichertes Wissen aber nur langsam herauskristallisiert. Und sich durchaus an gewissen Punkten herausstellen kann, dass Annahmen falsch waren und revidiert werden müssen. Oft entsteht Evidenz erst nach vielen Studien, von unterschiedlichen Wissenschaftlern. Und die „Wahrheit“ ist dann ein Konsensus, der zum Zeitpunkt X unter der Mehrheit der Wissenschaftler herrscht.
Wissenschaftliche Evidenz ist also ein empirischer Nachweis, der eine bestimmte Hypothese unterstützt. Mal sind damit die Ergebnisse einer einzelnen Studie gemeint, mal ist es der aktuelle Stand des Wissens bzw. der Konsensus, der sich nach vielen Studien herauskristallisiert hat. Solange es keine empirischen Nachweise für eine Hypothese gibt oder sie aus methodologischen Gründen nicht geliefert werden können, unterstützen Wissenschaftler auf Basis des verfügbaren Wissens die plausibelste Hypothese.
In Zeiten der Pandemie ist es schwer noch den Überblick zu behalten und alle Entwicklungen nachzuvollziehen. In diesem Artikel möchten wir anhand von konkreten Beispielen aus der Covid-Pandemie illustrieren, wie wissenschaftliche Evidenz entsteht, um Aussagen der Wissenschaft und (scheinbare) Wiedersprüche besser einordnen zu können - und was es Forschern, Politikern, Journalisten und der Öffentlichkeit in dieser Krisenzeit besonders schwer macht, mit wissenschaftlicher Evidenz bzw den Aussagen der Wissenschaft umzugehen.
Hierzu haben wir mit Prof. Rudi Balling gesprochen, dem Direktor des Luxembourg Center for Systems Biomedicine an der Universität Luxemburg.
Infobox
Der deutsche Entwicklungsbiologe und Genetiker Rudi Balling ist Direktor des Luxembourg Center for Systems Biomedicine (LCSB), eines interdisziplinären Forschungszentrums an der Universität Luxemburg. Er studierte Ernährung an den Universitäten Bonn und der Washington State University, USA und promovierte in Humanernährung an der Universität Aachen.
Nach Abschluss seiner Forschungsarbeiten am Samuel-Lunenfeld-Forschungsinstitut in Toronto und an den Max-Planck-Instituten in Göttingen und Freiburg wurde er 1993 Direktor des Instituts für Säugetiergenetik am GSF in München. Von 2001 bis 2009 war er wissenschaftlicher Direktor des Helmholtz Zentrums für Infektionsforschung in Braunschweig. 2009 wurde er Gründungsdirektor des LCSB an der Uni Luxemburg.
Wie entsteht wissenschaftliche Evidenz?
Am Anfang steht immer eine Frage
Als das neue Coronavirus sich in den ersten Monaten des Jahres 2020 ausbreitete, war eine zentrale Frage: Wie wird SARS-CoV-2 übertragen? Sind es hauptsächlich Schmierinfektionen, dann wären Hände- und Oberflächendesinfektion eine entscheidende Schutzmaßnahme. Breitet sich das Virus eher über Tröpfchen aus, könnten Masken Schutz bieten. Geht es über Aerosole, müssten zusätzlich zu den Masken Innenräume vermieden oder zumindest gut durchlüftet werden. Da es sich um ein neues Virus handelte, wussten Wissenschaftler darauf noch keine Antwort.
Von der Literaturrecherche zur Hypothese
„Am Anfang der Pandemie gab es keine Evidenz, wir konnten nur spekulieren, auf Basis von dem was wir über andere ähnliche Viren wissen“, sagt Rudi Balling. Wissenschaftler taten das, was sie zunächst immer tun, wenn sich eine neue Frage stellt: Sie durchkämmten die wissenschaftliche Literatur und formulierten Hypothesen – Annahmen, die dann durch Beobachtungen oder Experimente bewiesen oder widerlegt werden müssen. „Wir haben angenommen, dass es wie bei einer normalen Erkältung abläuft, also hauptsächlich über Schmierinfektionen und Tröpfchen. Ich habe damals noch alle Türen mit dem Ellenbogen aufgemacht, weil ich vermeiden wollte, meine Hände zu kontaminieren“, erinnert sich Rudi Balling.
Über systematische Datenerhebung zu neuen Erkenntnissen
„Es hat lange gedauert, bis sich herausgestellt hat, dass nicht Schmierinfektionen, sondern eine Mischung aus Tröpfchen und Aerosolen die Hauptübertragungswege sind. Diese Evidenz kam erst durch systematische Datenerhebung“, so Rudi Balling weiter. Hier in Luxemburg hätten ihm zufolge das Large Scale Testing-Programm und die Kontaktverfolgung zu dieser Erkenntnis beigetragen, auch wenn die Datenerhebung von Clustern und Transmissionswegen nicht einfach war. Und natürlich gab es Beobachtungen und Korrelationsstudien in anderen Ländern, die Zusammenhänge erfassten. „Das dauert und braucht statistisch robuste Fallzahlen“, so Rudi Balling.
Die politischen Entscheidungen, die auf dieser neuen Evidenz beruhten, kennen wir alle nur zu gut: Abstand halten und Kontakte vermeiden durch Schließungen von Restaurants, Cafés, Geschäften, Schulen, Fitnessstudios…und die leidige Maskenpflicht.
Evidenz als kontinuierlicher Prozess
Wissenschaftliche Evidenz ist oft nur ein Konsensus, der zum Zeitpunkt X unter der Mehrheit der Wissenschaftler herrscht. Dass Wissenschaftler ihre Meinung oder Position ändern, ist deshalb nicht ungewöhnlich, denn. „Wissenschaftliche Evidenz ist ein Kontinuum, sie wird ständig durch neue Erkenntnisse ergänzt, verfeinert, und mitunter auch widerlegt“, erklärt Rudi Balling.
Was für Wissenschaftler ein normaler Prozess ist, kann für Politik und Bevölkerung sehr verwirrend sein. Unverständnis gab es z.B., als die Maskenpflicht in der Corona-Pandemie eingeführt wurde. Zu Beginn hieß es: Masken bringen nichts. Dann plötzlich: Masken bringen doch etwas. Grund für diese Kursänderung war nicht ein Sinneswandel von Wissenschaftlern oder Politikern, sondern vor allem zwei Dinge: neue Evidenz zu Übertragungswegen und dem Konsens, dass der Nutzen von Gesichtsmasken als eine von mehreren Schutzmaßnahmen höher sein könnte als die Unbequemlichkeiten oder das Risiko möglicher Schäden, die durch das Maskentragen entstehen könnten.
Infobox
So lange es noch keine empirischen Nachweise gibt, baut die Wissenschaft auf plausiblen, wahrscheinlichen Hypothesen auf. Die mitunter auch die Basis für politische Entscheidungen bilden können. Diese Hypothesen sind allerdings nicht unfundiert: im Gegenteil, sie basieren auf dem bereits verfügbaren Wissen und wissenschaftlicher Literatur. Das ist Teil der Evidenzfindung. Und manchmal ist es sogar so, dass die Wissenschaft keinen eindeutigen Nachweis für eine Hypothese liefern kann. Weil es methodologische Probleme oder ein ethisches Dilemma beim Studiendesign gibt. Das Thema Gesichtsmasken ist hierfür ein gutes Beispiel. Die Hypothese lautet: wenn alle Masken tragen, kann dies dazu beitragen die Übertragung von SARS-CoV-2 in der Bevölkerung signifikant zu reduzieren. Einen eindeutigen Nachweis dieser Hypothese könnte nur eine kontrollierte Studie liefern, in der eine Bevölkerungsgruppe Masken trägt und eine andere nicht. Alle anderen Variablen (Alters- und Geschlechterverteilung, tägliche Kontakte, etc.) ist möglichst gleich. Und dann schaut man, in welcher Gruppe es statistisch zu mehr Ansteckungen bzw. Übertragungen kommt. Eine solche Studie ist aus methodologischen und ethischen Gründen aber quasi nicht machbar. Erstens wäre es schwierig zwei homogene Gruppen zu finden, die aber gleichzeitig repräsentativ für eine ganze Bevölkerung sind. Noch viel schwieriger ist aber festzustellen, ob Ansteckungen oder Übertragungen innerhalb der Gruppen denn tatsächlich auf das Tragen oder Nicht-Tragen von Masken zurückzuführen sind. Und wenn in einem Land Maskenpflicht herrscht, wäre es ethisch nicht vertretbar eine Gruppe Menschen bewusst einem erhöhten Risiko auszusetzen, sich und andere mit SARS-CoV-2 anzustecken.
Somit konnte die Wissenschaft bisher noch keinen direkten empirischen Nachweis für eine eindeutige Schutzfunktion von Geschichtsmasken liefern – und wird diesen wahrscheinlich auch nie liefern können. Es gibt aber dennoch wissenschaftliche Evidenz, die diese Hypothese unterstützt. Es gibt Studien die zeigen, dass Masken Aerosole zurückhalten können. Daneben gibt es positive Erfahrungswerte von anderen Pandemien bzw. aus verschiedenen Ländern, die u.a. durch eine Maskenpflicht die Ausbreitung von SARS-CoV-2 unter Kontrolle bringen konnten. Und es gibt Analysen bestimmter Eindämmungsstrategien. Evidenz kann also statt aus einem direkten empirischen Nachweis auch aus einem Puzzle aus indirekten Nachweisen entstehen. Deshalb lautet der Konsens beim Thema Masken: Sie helfen als eine von mehreren Schutzmaßnahmen.
„Auch die Rolle der Aerosole ist immer noch ein aktuelles Forschungsthema“, streicht Rudi Balling hervor. „In neueren Studien wurde gezeigt, dass sie stundenlang in der Luft bleiben können. Mittlerweile beteiligen sich auch Architekten und Ingenieure an dieser Forschung und untersuchen z.B., wie Aerosole sich in Hochhäusern ausbreiten.“
Welche Schwierigkeiten birgt die Corona-Krise für Wissenschaftler?
Der Faktor Zeit und Unsicherheiten
Es braucht also seine Zeit, bis sich Evidenz herauskristallisiert. Normalerweise haben Forscher diese Zeit auch. In der aktuellen Krise läuft ihnen die Zeit aber ständig davon. So müssen Politiker und auch die Bevölkerung mitunter Entscheidungen auf Basis von Evidenz treffen, die mit Unsicherheiten behaftet oder unvollständig ist. Entscheidungen in der Corona-Krise müssen also oft unter Einschätzung eines gewissen Risikos getroffen werden.
„Wissenschaftler können sagen ‚Ich weiß es nicht‘“, sagt Rudi Balling. Unwissen stellt einen Großteil ihres Alltags dar und sie suchen ständig nach neuer Evidenz, neuem Wissen, der Wahrheit. Eventuelle Unsicherheiten, wie auch Stärken und Schwächen ihrer Studien, kommunizieren und diskutieren sie nicht nur untereinander, sondern in der aktuellen Krise auch vermehrt in der Öffentlichkeit. Rudi Balling meint dazu: „Politiker haben dieses Gefühl für Unsicherheiten oft nicht, und müssen trotzdem Entscheidungen treffen. Und die Bevölkerung schaut auf beide, und so entsteht Angst. So kann schnell Misstrauen entstehen.“
Laut Rudi Balling haben wir es in der aktuellen Situation also mit einem Dilemma zu tun: „Wissenschaft braucht Zeit, aber politische Entscheidungen können nicht warten. Und die Bevölkerung hat auch keine Zeit, und fühlt sich als Opfer.“
Datenschutz und Transparenz
Ein weiteres Problem, das nicht nur luxemburgische Forscher plagt, ist der Zugang zu Daten von Gesundheitsämtern. Für Modellierungen der Fallzahlen seien qualitativ hochwertige und gut annotierte Daten aus Testergebnissen, dem Contact Tracing und Kliniken aber beispielsweise sehr wichtig, so Rudi Balling.
„Zu Beginn gab es ganz einfach keine digitalisierten Pipelines für Datenaustausch mit den Gesundheitsämtern“, präzisiert Rudi Balling, „doch auch heute ist es noch immer schwer für unsere Forscher, an belastbare Daten zu kommen.“ Ein Grund dafür sei der Datenschutz. Hier weist Rudi Balling auf ein weiteres ethisches Dilemma hin: „Es ist eine Sache, wie weit der Datenschutz in normalen Zeiten gehen darf. Aber sollte das gleiche Maß auch für Krisenzeiten gelten? Oder muss man dort kleine Abstriche machen, um schneller Lösungen für die Krise finden zu können?“
Austausch mit Politikern
Allgemein wünscht sich Rudi Balling mehr Austausch zwischen Wissenschaft und Politik – in beide Richtungen. „Mehr Austausch mit Politikern, Feedback und Transparenz wären wichtig, um eine Vertrauensbasis zu schaffen und optimal zusammenzuarbeiten“, sagt Rudi Balling.
In diesem Kontext nennt er als Beispiel die Evidenz zur Rolle von Kindern in der Pandemie. Am Anfang war nicht klar: sind sie gefährdet? Sind sie Überträger? Zusammen mit der Kinderärztin Isabel de la Fuente aus der Kannerklinik am CHL fasste Rudi Balling im Mai 2020 die wissenschaftliche Evidenz zu dem Thema in einem Policy Brief zusammen. Ihr Fazit damals: Kinder können sich anstecken und das Virus auch übertragen, sind aber oft asymptomatisch und weitaus weniger gefährdet für schwere Verläufe als Erwachsene und vor allem ältere Menschen. „Zuverlässige Daten über die Prävalenz, die Herdenimmunität oder die Dynamik der COVID-19-Pandemie bei Kindern in Luxemburg waren nicht vorhanden“, streicht Rudi Balling hervor. Diese sind aber als Basis für politische Entscheidungen im Bereich der Gesundheitsfürsorge von Kindern wichtig. Der Wissenschaftler und die Kinderärztin empfahlen deshalb, eine Kinder-Prävalenzstudie in Luxemburg durchzuführen. Das wurde aber dann nicht gemacht. Rudi Balling weiß bis heute nicht warum. „Es wäre für uns hilfreich zu wissen, welche wissenschaftliche Evidenz sich in politischen Entscheidungen wieder spiegelt.“
Kommunikationsprobleme
Doch auch Wissenschaftler können ihre Kommunikation verbessern. Hier bietet der der AstraZeneca-Impfstoff sicherlich genug Diskussionsstoff. Zur Erinnerung: nachdem die klinische Studie zweimal kurzzeitig unterbrochen wurde, bekam der Impfstoff seine provisorische Zulassung, wurde aber zunächst für über-65jährige nicht empfohlen. Dann wurden ältere Menschen trotzdem damit geimpft, und jetzt verimpfen manche Länder ihn gar nicht mehr oder nur noch an Menschen über 60 – weil es bei jüngeren Menschen in sehr seltenen Fällen zu Sinusvenenthrombosen nach der Impfung kam.
„Hier wurde immer nach dem Vorsichtsprinzip gehandelt“, sagt Rudi Balling. Es sei richtig gewesen, die Studie bzw. Impfungen zu stoppen. Um zu untersuchen, ob die beobachteten Zusammenhänge kausal auf die Impfung zurückgeführt werden können, und Nutzen-Risiko der Impfung erneut zu evaluieren.
„Da hat die Kommunikation versagt“, gibt Rudi Balling zu. „In Punkto wissenschaftlicher Evidenz ist da nichts schiefgelaufen“, versichert er, „aber die Gründe für die einzelnen Entscheidungen wurden nicht überzeugend kommuniziert.“ Es sei verständlich, dass da Misstrauen bei der Bevölkerung entsteht. Rudi Balling betrachtet es als ein Dilemma für die Kommunikation: „Einerseits ist es gut und wichtig, transparent zu kommunizieren, auf der anderen Seite können die wenigsten Laien Risiken abwägen, was dann zu Angst vor der Impfung führen kann.“
Infobox
Balling klärt auf: „Der Grund, warum der Astrazeneca-Impfstoff zunächst nicht für über-65jährige empfohlen wurde, war weil es ganz einfach keine Daten zur Verträglichkeit und Wirksamkeit für diese Altersgruppe gab. Weil diese in den klinischen Studien nicht eingeschlossen waren.“
Warum wurde Vaxzevria in den klinischen Studien nicht an über-65jährigen getestet? Sie stellen doch eine Risikogruppe dar, die auch jetzt prioritär geimpft wird? Rudi Balling nennt zwei Gründe: „Erstens versuchen Forscher möglichst homogene Gruppen in klinischen Studien zu vergleichen. Ist die Varianz innerhalb der Gruppen niedrig, haben die Forscher eine höhere Chance eine kausale Wirksamkeit festzustellen. Und am niedrigsten ist diese Varianz eben in jungen, gesunden Menschen ohne Komorbiditäten, also ohne andere Krankheiten.“ Mittlerweile ginge man bei vielen Studien allerdings von dieser Einstellung weg, so Rudi Balling weiter: „Man muss sich auch real-life-Situationen anschauen, aber dann in der Auswertung nach Altersgruppen aufschlüsseln, nicht nur einen pauschalen Mittelwert nehmen.“ Und der zweite Grund? „Zweitens kam eine wichtige Erkenntnis zeitverzögert: nämlich, dass hauptsächlich ältere Menschen schwere und tödliche Verläufe von Covid-19 hatten“, erklärt Rudi Balling. Am Anfang der Pandemie hätten Forscher oft den Vergleich mit der Influenza-Pandemie von 1918 gemacht (Spanische Grippe) und angenommen, dass auch Covid-19 hauptsächlich Jüngere treffen würde. Was sich dann als falsch herausgestellt hat. “Das Design der Impfstoffe begann bereits im Januar 2020, und die ersten klinischen Studien liefen bereits an bevor klar war, dass hauptsächlich ältere Menschen an Covid-19 versterben“, so Rudi Balling.
Nach der Zulassung haben dann einige Länder trotzdem beschlossen, ältere Personen mit dem AstraZeneca-Impfstoff zu impfen und haben festgestellt: der Impfstoff wirkt sehr wohl bei älteren Menschen. Man hatte eher das Gegenteil erwartet“, sagt Rudi Balling, „nämlich, dass die Impfung bei Älteren wegen dem abgeschwächten Immunsystem nicht so gut wirkt.“
Rudi Balling’s Einschätzung zu den seltenen Sinusvenusthrombosen, die im Zusammenhang mit Vaxzevria beobachtet wurden, findest Du weiter unten.
Welche Fehler können bei der Bewertung von wissenschaftlicher Evidenz gemacht werden?
Egal wie gut oder schlecht Wissenschaftler kommunizieren, es ist nicht immer einfach für Laien, ihre Mitteilungen zu interpretieren. Hier die häufigsten Fehler, die bei der Bewertung von wissenschaftlicher Evidenz passieren können.
„Finger pointing“ und das Präventionsparadox
„Man soll sich hüten mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Wir machen alle Fehler“, unterstreicht Rudi Balling. Er nennt ein Beispiel: „Modellierer der Covid-19 Task Force in Luxemburg lagen mit ihren Vorhersagen der Fallzahlen meist richtig. Aber einmal lagen sie falsch, in der zweiten Welle im Juli 2020 – da stiegen die Fallzahlen nicht wie vorhergesagt. Das hat gereicht, dass die Leute gesagt haben: Das ist ja alles falsch, was die vorhersagen.“
Doch auch wenn sie richtig liegen, sagen die Leute gerne: ja, so war das ja vorhergesagt. Oder es tritt das sogenannte Präventionsparadox ein. Es werden Eindämmungsmaßnahmen ergriffen und die Bevölkerung ändert ihr Verhalten – die Fallzahlen bleiben stabil oder sinken sogar. Und die Leute sagen: ist doch gar nicht so schlimm gekommen, wie die Forscher das vorhergesagt haben.
Nicht genug evidenzbasierte Risikokommunikation
Bleiben wir beim Beispiel der Modellierungen. „Die Wissenschaftler der Task Force haben ihre Fallzahlen eine Zeit lang mit den jeweiligen Unsicherheiten kommuniziert, was einem wahrscheinlichen, optimistischen und pessimistischen Szenario entspricht. Außerdem haben sie ein kurzfristige und eine langfristige Projektion vorgestellt. „Epidemiologische Szenarien zu modellieren ist sehr schwierig, es gibt viele Faktoren, die die Evolution der Fallzahlen beeinflussen können“, sagt Rudi Balling, „Das trifft besonders für die langfristigen Projektionen zu.“ Die Modellierungen sind also keine Wahrsagerei, sondern nur Projektionen, die Politikern bei ihren Entscheidungen helfen können.
Laut Balling müssten Journalisten unbedingt die Unsicherheiten der verfügbaren wissenschaftlichen Evidenz mit kommunizieren und sie sollten auch in der Lage sein, eine Risikoeinschätzung auf Ebene des gesunden Menschenverstandes zu liefern. „Was heißt eine 10%ige Wahrscheinlichkeit, dass das pessimistische Szenario eintritt? Was passiert, wenn das eintritt? Wie bereite ich das vor? Wann ist es vertretbar, Schulen zu schließen? Das hat natürlich auch viel mit der jeweiligen Kultur des Landes zu tun, aber es ist ein Problem, wenn Medien immer auf der Suche nach Schlagzeilen sind und von Click Rates angetrieben werden.“
In den Sozialen Netzwerken sei es schlimmer, meint Rudi Balling: „Manche Influencer werden pro Click bezahlt. Da gibt es welche, die alle drei Monate immer wieder dieselbe Nachricht von Retraction Watch publizieren, weil sie ihnen gute Click Rates bringt. Das ist ein ethisches Problem.“
Anmerkung der Redaktion: Retraction Watch ist ein Blog, das über wissenschaftliche Publikationen berichtet, die zurückgezogen wurden – sei es durch die Autoren selbst oder die Fachzeitschriften in denen sie veröffentlicht wurden.
Politischer Opportunismus
In der Corona-Krise müssen Politiker fast täglich Entscheidungen auf Basis von wissenschaftlicher Evidenz treffen. Die oft noch sehr heterogen oder mit Unsicherheiten behaftet ist. „Politiker suchen sich aber auch manchmal das heraus, was gut in ihre parteipolitische Agenda passt.“, meint Rudi Balling. Er denkt dabei an ein Projekt, in das im vergangenen Sommer viel Energie investiert wurde: die Entwicklung bzw. Anpassung einer Corona Tracing App für Luxemburg. Letztendlich entschied sich die Regierung aber dagegen – vielleicht auch, weil eine Contact-Tracing App nicht gut in ein liberales Konzept passt, denkt Rudi Balling.
Zu großer Fokus auf Einzelfallberichte und seltene Ereignisse
Ein weiterer häufiger Fehler: Rudi Balling zufolge lassen sich sowohl Politiker als auch Journalisten zu sehr von Einzelberichten von seltenen Ereignissen lenken.
Als Beispiel nennt er zunächst das Kawasaki-ähnliche Syndrom bei infizierten Kindern, das im Mai 2020 kurz vor Wiedereröffnung der Schulen für Aufregung sorgte. „Es handelt sich um eine sehr seltene systemische Erkrankung, die weltweit bei Kindern mit Virusinfektionen wie auch Covid-19 in etwa 9 von 100.000 Fällen auftreten kann und in der Regel gut mit Medikamenten behandelt werden kann. Laut der Kinderärztin Isabel de la Fuente der Kannerklinik des CHL treten in Luxemburg etwa 5 Fälle des Kawasaki-Syndroms pro Jahr bei Kindern mit Grippeinfektionen auf. Letztes Jahr gab es weniger Kawasaki-Fälle durch Grippe, aber ungefähr gleich viele durch Covid-19, die zudem alle behandelt werden konnten. In den Medien wurden den wenigen Kawasaki-Fällen in Luxemburg aber verhältnismäßig viel Aufmerksamkeit geschenkt.“
Ein aktuelleres Beispiel sind die sehr seltenen Thrombosen in Verbindung mit niedrigen Bluttplättchen, die meistens innerhalb von zwei Wochen nach Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff beobachtet wurden – besonders bei Frauen unter 60 (1 bis 2 Fälle pro 100.000 Frauen in Deutschland). „Zunächst gibt es immer nur Berichte von Einzelfällen, fundierte Evidenz entsteht erst durch systematische Datenerhebung. Dabei geht es darum zu erfassen, wie häufig ein Ereignis ist und ob es kausale Zusammenhänge gibt." so Rudi Balling. Dabei muss verglichen werden: Tritt das beobachtete seltene Ereignis unter Geimpften häufiger auf als man es rein zufällig unter normalen Umständen (also nicht-Geimpften) in der Bevölkerung erwarten würde? Mittlerweile haben europäische und britische Arzneimittelzulassungbehörden geschlussfolgert, dass die beobachteten Thrombosen eine „mögliche“ und „extrem seltene“ Nebenwirkung der Impfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff sind. Und daher in der Liste der möglichen Nebenwirkungen im Produktblatt aufgenommen werden sollte. Sie schätzen, dass im Durchschnitt etwa eine Person pro 200.000 – 250.000 Geimpften eine solche seltene Thrombose erleiden könnte. Sie stufen den Nutzen des Impfstoffs aber nach wie vor höher ein als mögliche Risiken - außer bei unter 30-jährigen, da bei diesen das Risiko eines schweren Verlaufes bei Covid-19 Erkrankung äußerst gering ist.
Empfehlungen mit wissenschaftlicher Evidenz gleichstellen
Ist ein Fazit einer europäischen Arzneimittelagentur (EMA) wissenschaftliche Evidenz? „Nein“, sagt Rudi Balling, „die EMA-Empfehlungen sind keine Evidenz, aber sie beruhen in der Regel auf Evidenz und bilden somit eine vertrauenswürdige Fürsorge für die Bevölkerung.“ Einrichtungen wie die EMA oder STIKO könnten nur kurzgefasste Empfehlungen aussprechen. Politiker müssen daraufhin Entscheidungen treffen, mit denen sie sowohl Minderheiten schützen als auch der Mehrheit genügen. „Wie schütze ich den Einzelnen, aber gleichzeitig auch die gesamte Bevölkerung? Das ist oft ein ethisches Dilemma. Hier kann der Dialog mit Ethik-Fachleuten sehr nützlich sein“, so Rudi Balling.
Fazit
Wissenschaftliche Evidenz sind Erkenntnisse aus der Forschung. Mithilfe von systematischen Methoden und kritischer Evaluierung versuchen Wissenschaftler Schritt für Schritt Antworten auf bestimmte Fragen zu finden – oder zumindest Unterstützung für ihre Hypothesen. Dieser Prozess braucht Zeit und mehrere Studien, so dass sich wissenschaftliche Evidenz oft nur langsam herauskristallisiert. Und diese Evidenz kann kontinuierlich erweitert, ergänzt und verfeinert – und unter Umständen auch wieder widerlegt werden.
Die Wissenschaft bewegt sich also zu einem Zeitpunkt X oft in einer Grauzone. Wissenschaftliche Evidenz ist oft mit Unsicherheiten behaftet und kann nicht immer definitive Antworten liefern. In öffentlichen Debatten, die auf wissenschaftlicher Evidenz basieren (sollen), kann das ein Problem sein. Wissenschaftler können eben nicht immer sagen, ob etwas schwarz oder weiß ist. Politische und individuelle Entscheidung werden aber auf Basis von Einschätzungen, die Wissenschaftler bieten, danach oft als schwarz oder weiß betrachtet oder dargestellt.
Für Wissenschaftler wäre es wichtig, klarer zu kommunizieren, was gewusst ist und was nicht, und mit welchen Unsicherheiten die aktuellste Evidenz einhergeht. Für Politiker, Journalisten und Einzelpersonen wäre es wichtig, immer alle verfügbaren Informationen zu betrachten und Entscheidungen auf Basis von Wahrscheinlichkeiten abzuwägen. Genau damit tun sich viele Nicht-Wissenschaftler aber oft schwer.
In beiden Fällen kann die Wissenschaftskommunikation helfen, Brücken zu schlagen und Einordnungen zu liefern.
Autor: Michèle Weber (FNR)
Editoren: Jean-Paul Bertemes (FNR), Sabine Schmitz (LCSB)